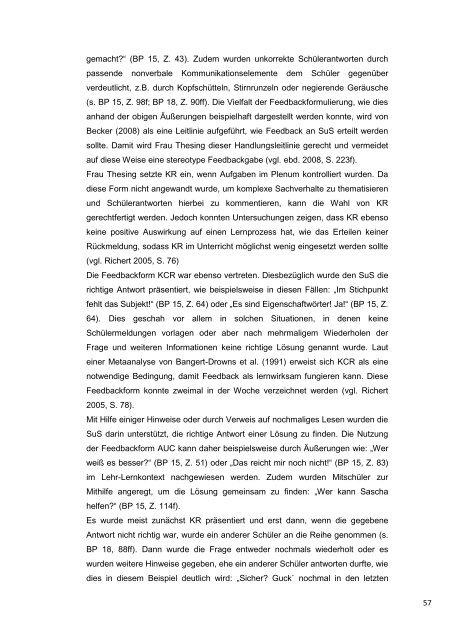Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gemacht?“ (BP 15, Z. 43). Zudem wurden unkorrekte Schülerantworten durch<br />
passende nonverbale Kommunikationselemente dem Schüler gegenüber<br />
verdeutlicht, z.B. durch Kopfschütteln, Stirnrunzeln oder negierende Geräusche<br />
(s. BP 15, Z. 98f; BP 18, Z. 90ff). Die Vielfalt der Feedbackformulierung, wie dies<br />
anhand der obigen Äußerungen beispielhaft dargestellt werden konnte, wird von<br />
Becker (2008) als eine Leitlinie aufgeführt, wie Feedback an SuS erteilt werden<br />
sollte. Damit wird Frau Thesing dieser Handlungsleitlinie gerecht und vermeidet<br />
auf diese Weise eine stereotype Feedbackgabe (vgl. ebd. 2008, S. 223f).<br />
Frau Thesing setzte KR ein, wenn Aufgaben im Plenum kontrolliert wurden. Da<br />
diese Form nicht angewandt wurde, um komplexe Sachverhalte zu thematisieren<br />
und Schülerantworten hierbei zu kommentieren, kann die Wahl von KR<br />
gerechtfertigt werden. Jedoch konnten Untersuchungen zeigen, <strong>das</strong>s KR ebenso<br />
keine positive Auswirkung auf einen Lernprozess hat, wie <strong>das</strong> Erteilen keiner<br />
Rückmeldung, so<strong>das</strong>s KR im Unterricht möglichst wenig eingesetzt werden sollte<br />
(vgl. Richert 2005, S. 76)<br />
Die Feedbackform KCR war ebenso vertreten. Diesbezüglich wurde den SuS die<br />
richtige Antwort präsentiert, wie beispielsweise in diesen Fällen: „Im Stichpunkt<br />
fehlt <strong>das</strong> Subjekt!“ (BP 15, Z. 64) oder „Es sind Eigenschaftwörter! Ja!“ (BP 15, Z.<br />
64). Dies geschah vor allem in solchen Situationen, in denen keine<br />
Schülermeldungen vorlagen oder aber nach mehrmaligem Wiederholen der<br />
Frage und weiteren Informationen keine richtige Lösung genannt wurde. Laut<br />
einer Metaanalyse von Bangert-Drowns et al. (1991) erweist sich KCR als eine<br />
notwendige Bedingung, damit Feedback als lernwirksam fungieren kann. Diese<br />
Feedbackform konnte zweimal in der Woche verzeichnet werden (vgl. Richert<br />
2005, S. 78).<br />
Mit Hilfe einiger Hinweise oder durch Verweis auf nochmaliges Lesen wurden die<br />
SuS darin unterstützt, die richtige Antwort einer Lösung zu finden. Die Nutzung<br />
der Feedbackform AUC kann daher beispielsweise durch Äußerungen wie: „Wer<br />
weiß es besser?“ (BP 15, Z. 51) oder „Das reicht mir noch nicht!“ (BP 15, Z. 83)<br />
im Lehr-Lernkontext nachgewiesen werden. Zudem wurden Mitschüler <strong>zur</strong><br />
Mithilfe angeregt, um die Lösung gemeinsam zu finden: „Wer kann Sascha<br />
helfen?“ (BP 15, Z. 114f).<br />
Es wurde meist zunächst KR präsentiert und erst dann, wenn die gegebene<br />
Antwort nicht richtig war, wurde ein anderer Schüler an die Reihe genommen (s.<br />
BP 18, 88ff). Dann wurde die Frage entweder nochmals wiederholt oder es<br />
wurden weitere Hinweise gegeben, ehe ein anderer Schüler antworten durfte, wie<br />
dies in diesem Beispiel deutlich wird: „Sicher? Guck` nochmal in den letzten<br />
57