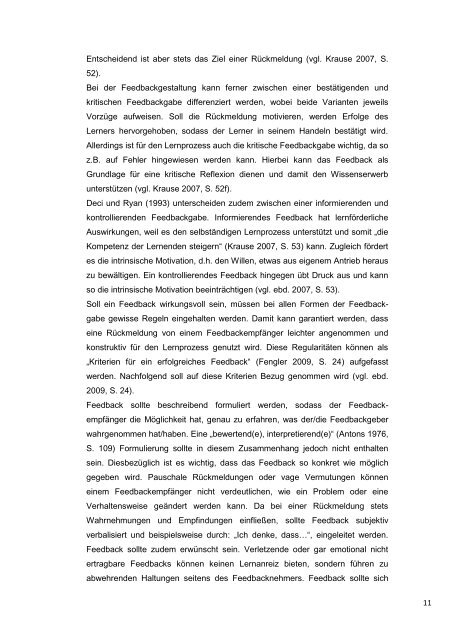Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Entscheidend ist aber stets <strong>das</strong> Ziel einer Rückmeldung (vgl. Krause 2007, S.<br />
52).<br />
Bei der Feedbackgestaltung kann ferner zwischen einer bestätigenden und<br />
kritischen Feedbackgabe differenziert werden, wobei beide Varianten jeweils<br />
Vorzüge aufweisen. Soll die Rückmeldung motivieren, werden Erfolge des<br />
Lerners hervorgehoben, so<strong>das</strong>s der Lerner in seinem Handeln bestätigt wird.<br />
Allerdings ist <strong>für</strong> den Lernprozess auch die kritische Feedbackgabe wichtig, da so<br />
z.B. auf Fehler hingewiesen werden kann. Hierbei kann <strong>das</strong> Feedback als<br />
Grundlage <strong>für</strong> eine kritische Reflexion dienen und damit den Wissenserwerb<br />
unterstützen (vgl. Krause 2007, S. 52f).<br />
Deci und Ryan (1993) unterscheiden zudem zwischen einer informierenden und<br />
kontrollierenden Feedbackgabe. Informierendes Feedback hat lernförderliche<br />
Auswirkungen, weil es den selbständigen Lernprozess unterstützt und somit „die<br />
Kompetenz der Lernenden steigern“ (Krause 2007, S. 53) kann. Zugleich fördert<br />
es die intrinsische Motivation, d.h. den Willen, etwas aus eigenem Antrieb heraus<br />
zu bewältigen. Ein kontrollierendes Feedback hingegen übt Druck aus und kann<br />
so die intrinsische Motivation beeinträchtigen (vgl. ebd. 2007, S. 53).<br />
Soll ein Feedback wirkungsvoll sein, müssen bei allen Formen der Feedback-<br />
gabe gewisse Regeln eingehalten werden. Damit kann garantiert werden, <strong>das</strong>s<br />
eine Rückmeldung von einem Feedbackempfänger leichter angenommen und<br />
konstruktiv <strong>für</strong> den Lernprozess genutzt wird. Diese Regularitäten können als<br />
„Kriterien <strong>für</strong> ein erfolgreiches Feedback“ (Fengler 2009, S. 24) aufgefasst<br />
werden. Nachfolgend soll auf diese Kriterien Bezug genommen wird (vgl. ebd.<br />
2009, S. 24).<br />
Feedback sollte beschreibend formuliert werden, so<strong>das</strong>s der Feedback-<br />
empfänger die Möglichkeit hat, genau zu erfahren, was der/die Feedbackgeber<br />
wahrgenommen hat/haben. Eine „bewertend(e), interpretierend(e)“ (Antons 1976,<br />
S. 109) Formulierung sollte in diesem Zusammenhang jedoch nicht enthalten<br />
sein. Diesbezüglich ist es wichtig, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> Feedback so konkret wie möglich<br />
gegeben wird. Pauschale Rückmeldungen oder vage Vermutungen können<br />
einem Feedbackempfänger nicht verdeutlichen, wie ein Problem oder eine<br />
Verhaltensweise geändert werden kann. Da bei einer Rückmeldung stets<br />
Wahrnehmungen und Empfindungen einfließen, sollte Feedback subjektiv<br />
verbalisiert und beispielsweise durch: „Ich denke, <strong>das</strong>s…“, eingeleitet werden.<br />
Feedback sollte zudem erwünscht sein. Verletzende oder gar emotional nicht<br />
ertragbare Feedbacks können keinen Lernanreiz bieten, sondern führen zu<br />
abwehrenden Haltungen seitens des Feedbacknehmers. Feedback sollte sich<br />
11