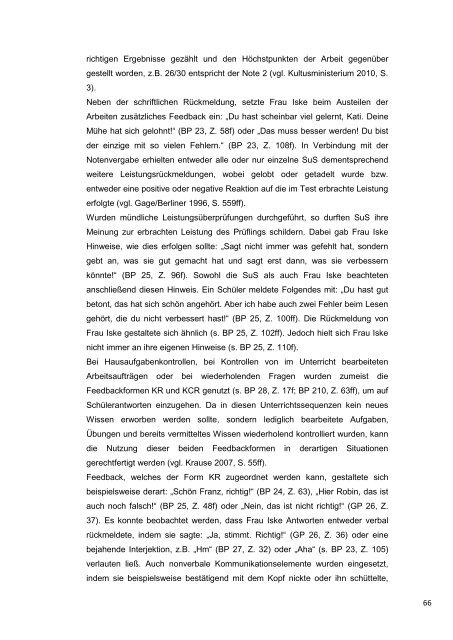Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ichtigen Ergebnisse gezählt und den Höchstpunkten der Arbeit gegenüber<br />
gestellt worden, z.B. 26/30 entspricht der Note 2 (vgl. Kultusministerium 2010, S.<br />
3).<br />
Neben der schriftlichen Rückmeldung, setzte Frau Iske beim Austeilen der<br />
Arbeiten zusätzliches Feedback ein: „Du hast scheinbar viel gelernt, Kati. Deine<br />
Mühe hat sich gelohnt!“ (BP 23, Z. 58f) oder „Das muss besser werden! Du bist<br />
der einzige mit so vielen Fehlern.“ (BP 23, Z. 108f). In Verbindung mit der<br />
Notenvergabe erhielten entweder alle oder nur einzelne SuS dementsprechend<br />
weitere Leistungsrückmeldungen, wobei gelobt oder getadelt wurde bzw.<br />
entweder eine positive oder negative Reaktion auf die im Test erbrachte Leistung<br />
erfolgte (vgl. Gage/Berliner 1996, S. 559ff).<br />
Wurden mündliche Leistungsüberprüfungen durchgeführt, so durften SuS ihre<br />
Meinung <strong>zur</strong> erbrachten Leistung des Prüflings schildern. Dabei gab Frau Iske<br />
Hinweise, wie dies erfolgen sollte: „Sagt nicht immer was gefehlt hat, sondern<br />
gebt an, was sie gut gemacht hat und sagt erst dann, was sie verbessern<br />
könnte!“ (BP 25, Z. 96f). Sowohl die SuS als auch Frau Iske beachteten<br />
anschließend diesen Hinweis. Ein Schüler meldete Folgendes mit: „Du hast gut<br />
betont, <strong>das</strong> hat sich schön angehört. Aber ich habe auch zwei Fehler beim Lesen<br />
gehört, die du nicht verbessert hast!“ (BP 25, Z. 100ff). Die Rückmeldung von<br />
Frau Iske gestaltete sich ähnlich (s. BP 25, Z. 102ff). Jedoch hielt sich Frau Iske<br />
nicht immer an ihre eigenen Hinweise (s. BP 25, Z. 110f).<br />
Bei Hausaufgabenkontrollen, bei Kontrollen von im Unterricht bearbeiteten<br />
Arbeitsaufträgen oder bei wiederholenden Fragen wurden zumeist die<br />
Feedbackformen KR und KCR genutzt (s. BP 28, Z. 17f; BP 210, Z. 63ff), um auf<br />
Schülerantworten einzugehen. Da in diesen Unterrichtssequenzen kein neues<br />
Wissen erworben werden sollte, sondern lediglich bearbeitete Aufgaben,<br />
Übungen und bereits vermitteltes Wissen wiederholend kontrolliert wurden, kann<br />
die Nutzung dieser beiden Feedbackformen in derartigen Situationen<br />
gerechtfertigt werden (vgl. Krause 2007, S. 55ff).<br />
Feedback, welches der Form KR zugeordnet werden kann, gestaltete sich<br />
beispielsweise derart: „Schön Franz, richtig!“ (BP 24, Z. 63), „Hier Robin, <strong>das</strong> ist<br />
auch noch falsch!“ (BP 25, Z. 48f) oder „Nein, <strong>das</strong> ist nicht richtig!“ (GP 26, Z.<br />
37). Es konnte beobachtet werden, <strong>das</strong>s Frau Iske Antworten entweder verbal<br />
rückmeldete, indem sie sagte: „Ja, stimmt. Richtig!“ (GP 26, Z. 36) oder eine<br />
bejahende Interjektion, z.B. „Hm“ (BP 27, Z. 32) oder „Aha“ (s. BP 23, Z. 105)<br />
verlauten ließ. Auch nonverbale Kommunikationselemente wurden eingesetzt,<br />
indem sie beispielsweise bestätigend mit dem Kopf nickte oder ihn schüttelte,<br />
66