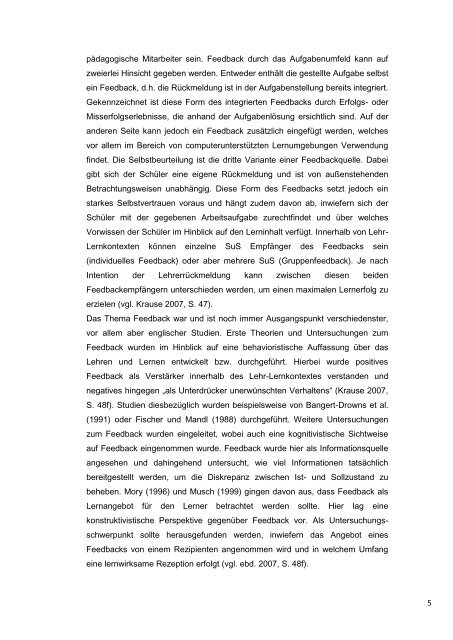Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
pädagogische Mitarbeiter sein. Feedback durch <strong>das</strong> Aufgabenumfeld kann auf<br />
zweierlei Hinsicht gegeben werden. Entweder enthält die gestellte Aufgabe selbst<br />
ein Feedback, d.h. die Rückmeldung ist in der Aufgabenstellung bereits integriert.<br />
Gekennzeichnet ist diese Form des integrierten Feedbacks durch Erfolgs- oder<br />
Misserfolgserlebnisse, die anhand der Aufgabenlösung ersichtlich sind. Auf der<br />
anderen Seite kann jedoch ein Feedback zusätzlich eingefügt werden, welches<br />
vor allem im Bereich von computerunterstützten Lernumgebungen Verwendung<br />
findet. Die Selbstbeurteilung ist die dritte Variante einer Feedbackquelle. Dabei<br />
gibt sich der Schüler eine eigene Rückmeldung und ist von außenstehenden<br />
Betrachtungsweisen unabhängig. Diese Form des Feedbacks setzt jedoch ein<br />
starkes Selbstvertrauen voraus und hängt zudem davon ab, inwiefern sich der<br />
Schüler mit der gegebenen Arbeitsaufgabe <strong>zur</strong>echtfindet und über welches<br />
Vorwissen der Schüler im Hinblick auf den Lerninhalt verfügt. Innerhalb von Lehr-<br />
Lernkontexten können einzelne SuS Empfänger des Feedbacks sein<br />
(individuelles Feedback) oder aber mehrere SuS (Gruppenfeedback). Je nach<br />
Intention der Lehrerrückmeldung kann zwischen diesen beiden<br />
Feedbackempfängern unterschieden werden, um einen maximalen Lernerfolg zu<br />
erzielen (vgl. Krause 2007, S. 47).<br />
Das Thema Feedback war und ist noch immer Ausgangspunkt verschiedenster,<br />
vor allem aber englischer Studien. Erste Theorien und Untersuchungen zum<br />
Feedback wurden im Hinblick auf eine behavioristische Auffassung über <strong>das</strong><br />
Lehren und Lernen entwickelt bzw. durchgeführt. Hierbei wurde positives<br />
Feedback als Verstärker innerhalb des Lehr-Lernkontextes verstanden und<br />
negatives hingegen „als Unterdrücker unerwünschten Verhaltens“ (Krause 2007,<br />
S. 48f). Studien diesbezüglich wurden beispielsweise von Bangert-Drowns et al.<br />
(1991) oder Fischer und Mandl (1988) durchgeführt. Weitere Untersuchungen<br />
zum Feedback wurden eingeleitet, wobei auch eine kognitivistische Sichtweise<br />
auf Feedback eingenommen wurde. Feedback wurde hier als Informationsquelle<br />
angesehen und dahingehend untersucht, wie viel Informationen tatsächlich<br />
bereitgestellt werden, um die Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand zu<br />
beheben. Mory (1996) und Musch (1999) gingen davon aus, <strong>das</strong>s Feedback als<br />
Lernangebot <strong>für</strong> den Lerner betrachtet werden sollte. Hier lag eine<br />
konstruktivistische Perspektive gegenüber Feedback vor. Als Untersuchungs-<br />
schwerpunkt sollte herausgefunden werden, inwiefern <strong>das</strong> Angebot eines<br />
Feedbacks von einem Rezipienten angenommen wird und in welchem Umfang<br />
eine lernwirksame Rezeption erfolgt (vgl. ebd. 2007, S. 48f).<br />
5