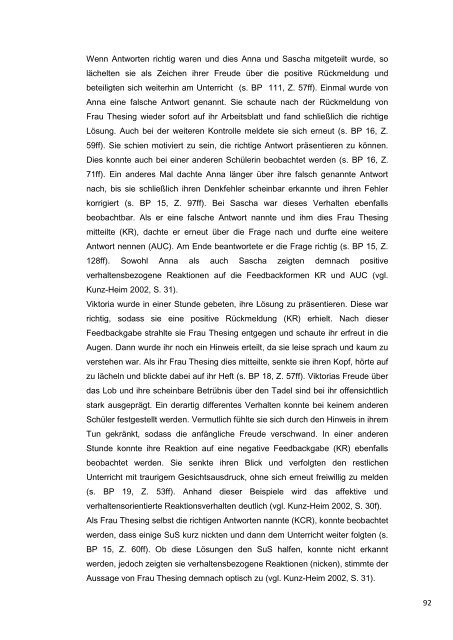Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wenn Antworten richtig waren und dies Anna und Sascha mitgeteilt wurde, so<br />
lächelten sie als Zeichen ihrer Freude über die positive Rückmeldung und<br />
beteiligten sich weiterhin am Unterricht (s. BP 111, Z. 57ff). Einmal wurde von<br />
Anna eine falsche Antwort genannt. Sie schaute nach der Rückmeldung von<br />
Frau Thesing wieder sofort auf ihr Arbeitsblatt und fand schließlich die richtige<br />
Lösung. Auch bei der weiteren Kontrolle meldete sie sich erneut (s. BP 16, Z.<br />
59ff). Sie schien motiviert zu sein, die richtige Antwort präsentieren zu können.<br />
Dies konnte auch bei einer anderen Schülerin beobachtet werden (s. BP 16, Z.<br />
71ff). Ein anderes Mal dachte Anna länger über ihre falsch genannte Antwort<br />
nach, bis sie schließlich ihren Denkfehler scheinbar erkannte und ihren Fehler<br />
korrigiert (s. BP 15, Z. 97ff). Bei Sascha war dieses Verhalten ebenfalls<br />
beobachtbar. Als er eine falsche Antwort nannte und ihm dies Frau Thesing<br />
mitteilte (KR), dachte er erneut über die Frage nach und durfte eine weitere<br />
Antwort nennen (AUC). Am Ende beantwortete er die Frage richtig (s. BP 15, Z.<br />
128ff). Sowohl Anna als auch Sascha zeigten demnach positive<br />
verhaltensbezogene Reaktionen auf die Feedbackformen KR und AUC (vgl.<br />
Kunz-Heim 2002, S. 31).<br />
Viktoria wurde in einer Stunde gebeten, ihre Lösung zu präsentieren. Diese war<br />
richtig, so<strong>das</strong>s sie eine positive Rückmeldung (KR) erhielt. Nach dieser<br />
Feedbackgabe strahlte sie Frau Thesing entgegen und schaute ihr erfreut in die<br />
Augen. Dann wurde ihr noch ein Hinweis erteilt, da sie leise sprach und kaum zu<br />
verstehen war. Als ihr Frau Thesing dies mitteilte, senkte sie ihren Kopf, hörte auf<br />
zu lächeln und blickte dabei auf ihr Heft (s. BP 18, Z. 57ff). Viktorias Freude über<br />
<strong>das</strong> Lob und ihre scheinbare Betrübnis über den Tadel sind bei ihr offensichtlich<br />
stark ausgeprägt. Ein derartig differentes Verhalten konnte bei keinem anderen<br />
Schüler festgestellt werden. Vermutlich fühlte sie sich durch den Hinweis in ihrem<br />
Tun gekränkt, so<strong>das</strong>s die anfängliche Freude verschwand. In einer anderen<br />
Stunde konnte ihre Reaktion auf eine negative Feedbackgabe (KR) ebenfalls<br />
beobachtet werden. Sie senkte ihren Blick und verfolgten den restlichen<br />
Unterricht mit traurigem Gesichtsausdruck, ohne sich erneut freiwillig zu melden<br />
(s. BP 19, Z. 53ff). Anhand dieser Beispiele wird <strong>das</strong> affektive und<br />
verhaltensorientierte Reaktionsverhalten deutlich (vgl. Kunz-Heim 2002, S. 30f).<br />
Als Frau Thesing selbst die richtigen Antworten nannte (KCR), konnte beobachtet<br />
werden, <strong>das</strong>s einige SuS kurz nickten und dann dem Unterricht weiter folgten (s.<br />
BP 15, Z. 60ff). Ob diese Lösungen den SuS halfen, konnte nicht erkannt<br />
werden, jedoch zeigten sie verhaltensbezogene Reaktionen (nicken), stimmte der<br />
Aussage von Frau Thesing demnach optisch zu (vgl. Kunz-Heim 2002, S. 31).<br />
92