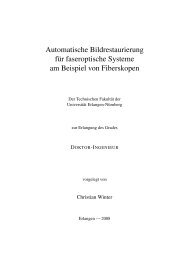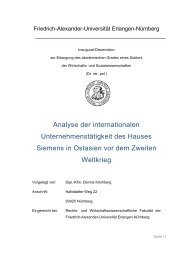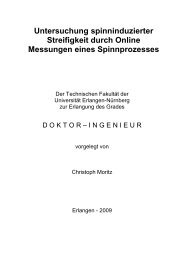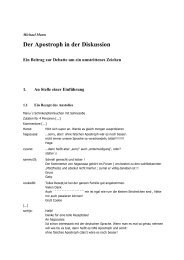- Seite 1 und 2:
„Psychoedukation Angst bei statio
- Seite 3 und 4:
„Psychoedukation Angst bei statio
- Seite 5 und 6:
Inhaltsverzeichnis I. Theoretischer
- Seite 7 und 8:
Inhaltsverzeichnis 5.3.3 Neurobiolo
- Seite 9 und 10:
Inhaltsverzeichnis 8.2 Stundenbeurt
- Seite 11 und 12:
Einleitung 11 1 Einleitung „Angst
- Seite 13 und 14:
Einleitung 13 Psychoedukation beleu
- Seite 15 und 16: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 17 und 18: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 19 und 20: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 21 und 22: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 23 und 24: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 25 und 26: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 27 und 28: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 29 und 30: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 31 und 32: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 33 und 34: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 35 und 36: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 37 und 38: Psychoedukation bei psychischen Erk
- Seite 39 und 40: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 41 und 42: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 43 und 44: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 45 und 46: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 47 und 48: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 49 und 50: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 51 und 52: Theoretische Grundlagen der Psychoe
- Seite 53 und 54: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 55 und 56: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 57 und 58: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 59 und 60: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 61 und 62: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 63 und 64: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 65: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 69 und 70: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 71 und 72: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 73 und 74: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 75 und 76: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 77 und 78: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 79 und 80: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 81 und 82: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 83 und 84: Psychoedukation bei Angststörungen
- Seite 85 und 86: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 87 und 88: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 89 und 90: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 91 und 92: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 93 und 94: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 95 und 96: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 97 und 98: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 99 und 100: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 101 und 102: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 103 und 104: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 105 und 106: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 107 und 108: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 109 und 110: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 111 und 112: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 113 und 114: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 115 und 116: Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 117 und 118:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 119 und 120:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 121 und 122:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 123 und 124:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 125 und 126:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 127 und 128:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 129 und 130:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 131 und 132:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 133 und 134:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 135 und 136:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 137 und 138:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 139 und 140:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 141 und 142:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 143 und 144:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 145 und 146:
Das Gruppenprogramm „PAsta“ - E
- Seite 147 und 148:
Zielsetzung und Fragestellung der S
- Seite 149 und 150:
Methode 7 Methode 7.1 Rahmenbedingu
- Seite 151 und 152:
Methode 151 vorzeitigem Ausscheiden
- Seite 153 und 154:
Methode 7.2.1 Formative Evaluation
- Seite 155 und 156:
Methode 155 physiologische Symptome
- Seite 157 und 158:
Methode 157 Korrelationen mit ander
- Seite 159 und 160:
Methode 159 kriterienbezogenen Vali
- Seite 161 und 162:
Methode Soziale Externalität (FKK-
- Seite 163 und 164:
Methode 163 pathologisch eingestuft
- Seite 165 und 166:
Methode Tabelle 17. Studiendesign f
- Seite 167 und 168:
Methode dBehandlungseffekt = [(MTG(
- Seite 169 und 170:
Methode 169 Bei der Vergabe der Ers
- Seite 171 und 172:
Methode Merkmal N % Komorbidität (
- Seite 173 und 174:
Methode Abbildung 19. Erstdiagnosen
- Seite 175 und 176:
Ergebnis 8 Ergebnisse der formative
- Seite 177 und 178:
Ergebnis 177 großer Teil der Patie
- Seite 179 und 180:
Ergebnis 179 Die Erklärungen des G
- Seite 181 und 182:
Ergebnis 181 In der Stundenbeurteil
- Seite 183 und 184:
Ergebnis 9 Ergebnisse der summative
- Seite 185 und 186:
Ergebnis 185 Tabelle 20. Mittelwert
- Seite 187 und 188:
Ergebnis 187 Psychoedukationsgruppe
- Seite 189 und 190:
Ergebnis 9.3.2 Das Wissen über Ang
- Seite 191 und 192:
Ergebnis 9.3.4 Die kognitiven Varia
- Seite 193 und 194:
Ergebnis KOGNITIVE VARIABLEN Kohär
- Seite 195 und 196:
Ergebnis t1 t2 195 M SD M SD ES Leb
- Seite 197 und 198:
Ergebnis 9.4.4 Die kognitiven Varia
- Seite 199 und 200:
Ergebnis 199 Nach Kontrolle der Vor
- Seite 201 und 202:
Ergebnis Gruppe BSI - Aggressivitä
- Seite 203 und 204:
Ergebnis Gruppe FKK - Sozial beding
- Seite 205 und 206:
Diskussion 205 Zusammenfassend läs
- Seite 207 und 208:
Diskussion 207 werden. Denn im Rahm
- Seite 209 und 210:
Diskussion 209 vier Wochen dieses Z
- Seite 211 und 212:
Diskussion 211 kognitiven Strategie
- Seite 213 und 214:
Diskussion 213 schwer gestörten, s
- Seite 215 und 216:
Diskussion 215 Fähigkeiten als ein
- Seite 217 und 218:
Diskussion 217 Psychoedukationsgrup
- Seite 219 und 220:
Diskussion 219 sondern auch die kog
- Seite 221 und 222:
Zusammenfassung 221 Bedürfnisse st
- Seite 223 und 224:
Zusammenfassung 223 Ergebnisse beur
- Seite 225 und 226:
Literaturverzeichnis Bagby, R.M., T
- Seite 227 und 228:
Literaturverzeichnis Birbaumer, N.
- Seite 229 und 230:
Literaturverzeichnis Fiedler, P. (1
- Seite 231 und 232:
Literaturverzeichnis Kanfer, F.H.,
- Seite 233 und 234:
Literaturverzeichnis Lovibond, S.H.
- Seite 235 und 236:
Literaturverzeichnis Pitschel-Walz,
- Seite 237 und 238:
Literaturverzeichnis Schmidt-Traub,
- Seite 239 und 240:
Literaturverzeichnis Weems, C.F., B
- Seite 241 und 242:
Anhang 13 Anhang Anhang A: Die Sitz
- Seite 243 und 244:
Anhang Anhang D: Die Messintrumente
- Seite 245 und 246:
Anhang A: Die Sitzungen des Gruppen
- Seite 247 und 248:
FLIPCHART Eine typische Angstsituat
- Seite 249 und 250:
FLIPCHART Therapiemöglich keiten i
- Seite 251 und 252:
ÜBUNG „Lippenbremse“ durchfüh
- Seite 253 und 254:
FOLIE 7 Gehirnmodell AB 9 Methoden
- Seite 255 und 256:
FLIPCHART Korrektur der häufigsten
- Seite 257 und 258:
FOLIE 10 Medikamente AB 9 Methoden
- Seite 259 und 260:
FOLIE 12 ABC-Modell DISKUSSION „W
- Seite 261 und 262:
FOLIE 14 AB 11 Beobachtungs- bogen
- Seite 263 und 264:
FOLIE 15a,b,c Denkmuster DISKUSSION
- Seite 265 und 266:
Gestern schon grüßte er mich nur
- Seite 267 und 268:
SITZUNG 6: Strategien im Umgang mit
- Seite 269 und 270:
sammeln 2.Eine Angst auswählen 3.
- Seite 271 und 272:
SITZUNG 7: Strategien im Umgang mit
- Seite 273 und 274:
FOLIE 20 Expositions- regeln entlar
- Seite 275 und 276:
SITZUNG 8: Sich auf den Ernstfall v
- Seite 277 und 278:
Anhang B: Die Folien des Gruppenpro
- Seite 279 und 280:
Folie 2: Gefühlskreis Scham Trauer
- Seite 281 und 282:
Meine Auslöser: Meine körperliche
- Seite 283 und 284:
Auslösende Faktoren Folie 6: Drei-
- Seite 285 und 286:
Folie 8: Körperliche Symptome der
- Seite 287 und 288:
Folie 10: Medikamente bei Angst Med
- Seite 289 und 290:
A Auslösende Situation B Bewertung
- Seite 291 und 292:
Situation Wählen Sie eine konkrete
- Seite 293 und 294:
„Besser den Kopf in den Sand stec
- Seite 295 und 296:
Folie 16: Denkmuster Korrektur Korr
- Seite 297 und 298:
10 20 30 40 Folie 18: Angsthierarch
- Seite 299 und 300:
Folie 20: Expositionsregeln Regeln
- Seite 301 und 302:
Folie 22: Angstregeln 10 Regeln zur
- Seite 303 und 304:
Station P21 Gruppe: AB 1: Teilnehme
- Seite 305 und 306:
Einladung zur Psychoedukationsgrupp
- Seite 307 und 308:
AB 5: Vorstellungsrunde Vorstellung
- Seite 309 und 310:
Meine Auslöser: Meine körperliche
- Seite 311 und 312:
AB 9: Methoden zur Erregungskontrol
- Seite 313 und 314:
AB10: Körperliche Symptome der Ang
- Seite 315 und 316:
AB 12: Denkmuster Typische Denkmust
- Seite 317 und 318:
10 20 30 40 AB 13: Angsthierarchie
- Seite 319 und 320:
AB 15: Expositionsregeln Regeln der
- Seite 321 und 322:
AB 17: Angstregeln 10 Regeln zur An
- Seite 323 und 324:
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebo
- Seite 325 und 326:
P21 Allg Fra Datum: __ __. __ __. _
- Seite 327 und 328:
P21 BDI Datum: __ __. __ __. __ __
- Seite 329 und 330:
P21 BSI Datum: __ __. __ __. __ __
- Seite 331 und 332:
Anleitung Fragebogen FKK (G. Krampe
- Seite 333 und 334:
P21 FKK Datum: __ __. __ __. __ __
- Seite 335 und 336:
P21 SOC Datum: __ __. __ __. __ __
- Seite 337 und 338:
P21 WissA Datum: __ __. __ __. __ _
- Seite 339 und 340:
P21 Stunden- beurteilung Patient Da