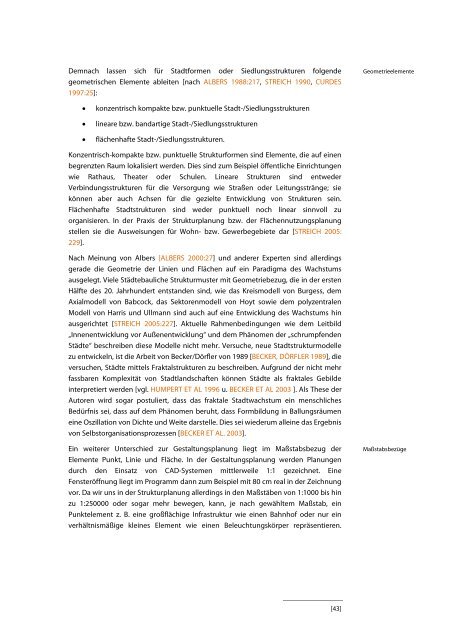Echtzeitplanung - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Echtzeitplanung - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Echtzeitplanung - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Demnach lassen sich für Stadtformen oder Siedlungsstrukturen folgende<br />
geometrischen Elemente ableiten [nach ALBERS 1988:217, STREICH 1990, CURDES<br />
1997:25]:<br />
• konzentrisch kompakte bzw. punktuelle Stadt-/Siedlungsstrukturen<br />
• lineare bzw. bandartige Stadt-/Siedlungsstrukturen<br />
• flächenhafte Stadt-/Siedlungsstrukturen.<br />
Konzentrisch-kompakte bzw. punktuelle Strukturformen sind Elemente, die auf einen<br />
begrenzten Raum lokalisiert werden. Dies sind zum Beispiel öffentliche Einrichtungen<br />
wie Rathaus, Theater oder Schulen. Lineare Strukturen sind entweder<br />
Verbindungsstrukturen für die Versorgung wie Straßen oder Leitungsstränge; sie<br />
können aber auch Achsen für die gezielte Entwicklung von Strukturen sein.<br />
Flächenhafte Stadtstrukturen sind weder punktuell noch linear sinnvoll zu<br />
organisieren. In der Praxis der Strukturplanung bzw. der Flächennutzungsplanung<br />
stellen sie die Ausweisungen für Wohn- bzw. Gewerbegebiete dar [STREICH 2005:<br />
229].<br />
Nach Meinung von Albers [ALBERS 2000:27] und anderer Experten sind allerdings<br />
gerade die Geometrie der Linien und Flächen auf ein Paradigma des Wachstums<br />
ausgelegt. Viele Städtebauliche Strukturmuster mit Geometriebezug, die in der ersten<br />
Hälfte des 20. Jahrhundert entstanden sind, wie das Kreismodell von Burgess, dem<br />
Axialmodell von Babcock, das Sektorenmodell von Hoyt sowie dem polyzentralen<br />
Modell von Harris und Ullmann sind auch auf eine Entwicklung des Wachstums hin<br />
ausgerichtet [STREICH 2005:227]. Aktuelle Rahmenbedingungen wie dem Leitbild<br />
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und dem Phänomen der „schrumpfenden<br />
Städte“ beschreiben diese Modelle nicht mehr. Versuche, neue Stadtstrukturmodelle<br />
zu entwickeln, ist die Arbeit von Becker/Dörfler von 1989 [BECKER, DÖRFLER 1989], die<br />
versuchen, Städte mittels Fraktalstrukturen zu beschreiben. Aufgrund der nicht mehr<br />
fassbaren Komplexität von Stadtlandschaften können Städte als fraktales Gebilde<br />
interpretiert werden [vgl. HUMPERT ET AL 1996 u. BECKER ET AL 2003 ]. Als These der<br />
Autoren wird sogar postuliert, dass das fraktale Stadtwachstum ein menschliches<br />
Bedürfnis sei, dass auf dem Phänomen beruht, dass Formbildung in Ballungsräumen<br />
eine Oszillation von Dichte und Weite darstelle. Dies sei wiederum alleine das Ergebnis<br />
von Selbstorganisationsprozessen [BECKER ET AL. 2003].<br />
Ein weiterer Unterschied zur Gestaltungsplanung liegt im Maßstabsbezug der<br />
Elemente Punkt, Linie und Fläche. In der Gestaltungsplanung werden Planungen<br />
durch den Einsatz von CAD-Systemen mittlerweile 1:1 gezeichnet. Eine<br />
Fensteröffnung liegt im Programm dann zum Beispiel mit 80 cm real in der Zeichnung<br />
vor. Da wir uns in der Strukturplanung allerdings in den Maßstäben von 1:1000 bis hin<br />
zu 1:250000 oder sogar mehr bewegen, kann, je nach gewähltem Maßstab, ein<br />
Punktelement z. B. eine großflächige Infrastruktur wie einen Bahnhof oder nur ein<br />
verhältnismäßige kleines Element wie einen Beleuchtungskörper repräsentieren.<br />
[43]<br />
Geometrieelemente<br />
Maßstabsbezüge