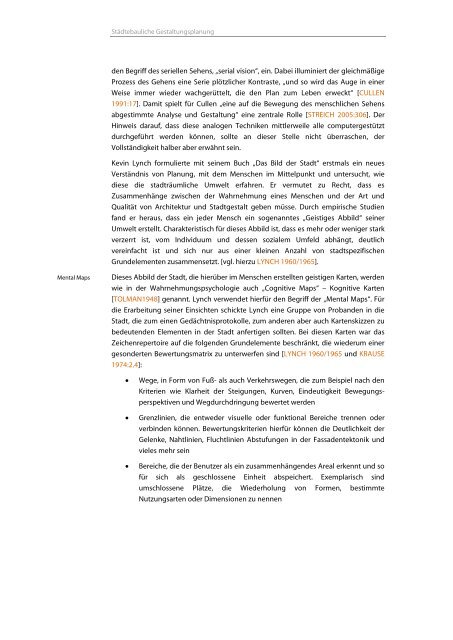Echtzeitplanung - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Echtzeitplanung - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Echtzeitplanung - KLUEDO - Universität Kaiserslautern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mental Maps<br />
Städtebauliche Gestaltungsplanung<br />
den Begriff des seriellen Sehens, „serial vision“, ein. Dabei illuminiert der gleichmäßige<br />
Prozess des Gehens eine Serie plötzlicher Kontraste, „und so wird das Auge in einer<br />
Weise immer wieder wachgerüttelt, die den Plan zum Leben erweckt“ [CULLEN<br />
1991:17]. Damit spielt für Cullen „eine auf die Bewegung des menschlichen Sehens<br />
abgestimmte Analyse und Gestaltung“ eine zentrale Rolle [STREICH 2005:306]. Der<br />
Hinweis darauf, dass diese analogen Techniken mittlerweile alle computergestützt<br />
durchgeführt werden können, sollte an dieser Stelle nicht überraschen, der<br />
Vollständigkeit halber aber erwähnt sein.<br />
Kevin Lynch formulierte mit seinem Buch „Das Bild der Stadt“ erstmals ein neues<br />
Verständnis von Planung, mit dem Menschen im Mittelpunkt und untersucht, wie<br />
diese die stadträumliche Umwelt erfahren. Er vermutet zu Recht, dass es<br />
Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung eines Menschen und der Art und<br />
Qualität von Architektur und Stadtgestalt geben müsse. Durch empirische Studien<br />
fand er heraus, dass ein jeder Mensch ein sogenanntes „Geistiges Abbild“ seiner<br />
Umwelt erstellt. Charakteristisch für dieses Abbild ist, dass es mehr oder weniger stark<br />
verzerrt ist, vom Individuum und dessen sozialem Umfeld abhängt, deutlich<br />
vereinfacht ist und sich nur aus einer kleinen Anzahl von stadtspezifischen<br />
Grundelementen zusammensetzt. [vgl. hierzu LYNCH 1960/1965].<br />
Dieses Abbild der Stadt, die hierüber im Menschen erstellten geistigen Karten, werden<br />
wie in der Wahrnehmungspsychologie auch „Cognitive Maps“ – Kognitive Karten<br />
[TOLMAN1948] genannt. Lynch verwendet hierfür den Begriff der „Mental Maps“. Für<br />
die Erarbeitung seiner Einsichten schickte Lynch eine Gruppe von Probanden in die<br />
Stadt, die zum einen Gedächtnisprotokolle, zum anderen aber auch Kartenskizzen zu<br />
bedeutenden Elementen in der Stadt anfertigen sollten. Bei diesen Karten war das<br />
Zeichenrepertoire auf die folgenden Grundelemente beschränkt, die wiederum einer<br />
gesonderten Bewertungsmatrix zu unterwerfen sind [LYNCH 1960/1965 und KRAUSE<br />
1974:2.4]:<br />
• Wege, in Form von Fuß- als auch Verkehrswegen, die zum Beispiel nach den<br />
Kriterien wie Klarheit der Steigungen, Kurven, Eindeutigkeit Bewegungsperspektiven<br />
und Wegdurchdringung bewertet werden<br />
• Grenzlinien, die entweder visuelle oder funktional Bereiche trennen oder<br />
verbinden können. Bewertungskriterien hierfür können die Deutlichkeit der<br />
Gelenke, Nahtlinien, Fluchtlinien Abstufungen in der Fassadentektonik und<br />
vieles mehr sein<br />
• Bereiche, die der Benutzer als ein zusammenhängendes Areal erkennt und so<br />
für sich als geschlossene Einheit abspeichert. Exemplarisch sind<br />
umschlossene Plätze, die Wiederholung von Formen, bestimmte<br />
Nutzungsarten oder Dimensionen zu nennen