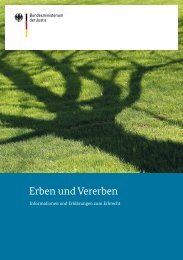Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
108<br />
KLAUS BOERS<br />
terschaft sprechen kann. 11 Dies ist nur anzunehmen, wenn ein Mehrfach- oder Intensivtäter<br />
über mehrere (Mehrfach- oder Intensivtäter-) Zeiteinheiten hinweg ohne große<br />
Unterbrechungen aktiv ist. Die Zeitdimension wird hier also in umgekehrter Richtung<br />
bedeutsam: Nun grenzt sie den Begriff nicht ein, sondern lässt ihn erst nach einer gewissen<br />
Dauer zu. Ein Mehrfach- oder Intensivtäter ist demnach nicht unbedingt auch<br />
schon ein persistenter Täter. Ohne bislang noch nicht <strong>vor</strong>handene spezifische empirische<br />
Analysen zur Dauer und Unterbrechung persistenter Verläufe ist es jedoch<br />
schwierig, eine minimale Zeitspanne für die Annahme eines persistenten Verlaufs zu<br />
bestimmen. Sie sollte aber, um die Bezeichnung „dauerhaft“ zu rechtfertigen, wohl<br />
drei bis vier Jahre betragen. 12 Die Unterbrechungen müssen eine ebenfalls konkret zu<br />
bestimmende maximale Dauer aufweisen und wären mitunter auch bei einer phasenweise<br />
deutlich geringeren Deliktschwere (zum Beispiel unter dem Intensivtäterniveau)<br />
in Betracht zu ziehen. 13 Somit kommt es darauf an, dass bei Verwendung des Persistenzbegriffs<br />
die zu Grunde gelegte minimale Delinquenz- sowie maximale Unterbrechungsdauer<br />
offen gelegt werden. Letztendlich muss die kriminologische Forschung<br />
und Diskussion ergeben, inwieweit die gewählten Kriterien plausibel sind.<br />
Im Unterschied zum (normativ auf Intensivtäter fixierten) Karrierebegriff kann der<br />
Persistenzbegriff mithin auch zur analytischen Beschreibung eines Delinquenzverlaufs<br />
11<br />
Wie bereits eingangs angedeutet geht es hier um so genannte „kriminelle Karrieren“. Es wird jedoch<br />
<strong>vor</strong>geschlagen, auf diesen Begriff zu Gunsten des im Englischen üblich gewordenen Begriffs der Persistenz<br />
zu verzichten. Auch wenn Howard Becker (1963, S. 25 ff.) den Karrierebegriff erstmals (im<br />
Sinne einer devianten Laufbahn, wörtlich: „deviant career“) zur wissenschaftlichen Beschreibung einer<br />
Etikettierungskarriere verwendete, so hat er heute häufig eine bestimmte kriminalpolitische, nämlich<br />
stigmatisierende bzw. dramatisierende Konnotation. Zudem suggeriert der Begriff „Karriere“, es<br />
handele sich (wie etwa bei einer Berufskarriere) um eine geplante Laufbahn, was bei einer persistenten<br />
Delinquenzentwicklung allerdings eher selten der Fall zu sein scheint. Als analytischer Begriff ist er<br />
mithin nicht sonderlich geeignet.<br />
12<br />
Eine etwaige Begrenzung persistenter Verläufe anhand bestimmter Lebensphasen (zum Beispiel Jugend-<br />
oder Erwachsenenalter) würde der empirischen Erfahrung widersprechen, da diese typischerweise<br />
die Grenzen oder den gesamten Zeitraum solcher Lebensphasen übergreifen, zum Beispiel im<br />
späten Kindesalter beginnen und bis Anfang oder gar Mitte Zwanzig dauern können. Somit besteht für<br />
persistente Verläufe potentiell ein größerer, von den Lebensphasen unabhängiger zeitlicher Ereignisraum.<br />
13<br />
Die Bestimmung einer maximalen Unterbrechungsdauer ist schwierig und hängt zunächst davon ab,<br />
ob es sich um einmalige (oder ganz wenige) oder um über die gesamte Delinquenzzeit mehr oder weniger<br />
verteilte Unterbrechungen handelt. Im ersten Fall wird die maximale Unterbrechungszeit, etwa<br />
mit einem Viertel der Persistenzdauer, recht eng zu bemessen sein. Bei einer Persistenz von vier Jahren<br />
würde also eine andauernde Unterbrechung von maximal 12 Monaten eine Persistenzannahme gerade<br />
noch erlauben. Bei Annahme eines Drittels würde eine 16 Monate andauernde Unterbrechung eine<br />
Persistenz jedoch in Frage stellen. Dies gilt umso mehr, je länger die Persistenzdauer ist: Eine<br />
durchgehende vierjährige Latenzzeit innerhalb eines Delinquenzzeitraums von 12 Jahren lässt schon<br />
eher an einen <strong>vor</strong>übergehenden Abbruchsprozess als an eine Persistenzunterbrechung denken. Die Bestimmung<br />
der Unterbrechungsdauer hängt mithin zum einen mit der Persistenzdauer zusammen und<br />
zum anderen wird mit fortdauernder Persistenz der Unterschied zwischen Unterbrechung und Abbruch<br />
fließend. Im oben genannten zweiten Falle, also den über einen Delinquenzzeitraum mehr oder weniger<br />
verteilten Unterbrechungen, wird man die maximale Unterbrechungsdauer indessen größer, etwa<br />
bis zur Hälfte, bemessen können (so könnte bei jährlich maximal sechsmonatigen Latenzen einer im<br />
Minimum vierjährigen Delinquenzzeit wohl noch eine persistente Entwicklung angenommen werden).