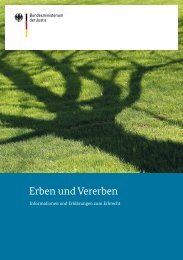Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KONTINUITÄT UND ABBRUCH PERSISTENTER DELINQUENZVERLÄUFE 123<br />
onen begleiteten staatsanwaltlichen Einstellungen nach § 45 JGG, also die Diversion<br />
im engeren Sinne, keinen signifikanten Einfluss auf die weitere selbstberichtete Delinquenz<br />
hatten (a.a.O., S. 203 ff.) und damit die in Deutschland <strong>vor</strong>herrschende Auffassung<br />
unterstützt wird, dass sich (informelle) Diversionsentscheidungen zumindest<br />
nicht negativer auf einen delinquenten Karriereverlauf auswirken als formelle Sanktionierungen<br />
(Heinz 1998; 1999, mit Blick auf den Rückfall auch 2004, S. 43 ff.; Brunner<br />
und Dölling 2002, § 45, Rn. 4 ff.; Ostendorf 2007, Grdl. z. §§ 45 u. 47, Rn. 4 ff.<br />
m.w.N.). Angesichts dieser Befunde deutet sich allmählich ein differenzierteres Zusammenhangsbild<br />
an. In Rochester und Bremen sowie – mit Einschränkungen hinsichtlich<br />
der direkten Effekte – in der Reanalyse der Gluecks-Daten zeigte sich, dass<br />
neben sich wechselseitig verstärkenden sozialstrukturell begründeten Nachteilen<br />
(schulischer und beruflicher Misserfolg, Cliquenzugehörigkeit) einerseits und der<br />
Fortsetzung <strong>vor</strong>hergehender Delinquenz andererseits, formelle Sanktionen die weitere<br />
Delinquenzentwicklung eigenständig und bedeutsam verstärken können.<br />
Freilich sind damit die zuletzt von Paternoster und Iovanni modellierten komplexen<br />
Zusammenhänge zwischen Primärverhalten, Labelingprozessen und Sekundärverhalten<br />
<strong>vor</strong> dem Hintergrund einer in sozialen Interaktionen reproduzierten Sozialstruktur<br />
nur erst in Ansätzen empirisch analysiert worden. Es fehlen beispielsweise Untersuchungen<br />
darüber, wie öffentliche formelle Etikettierungen sozial vermittelt werden,<br />
also wie sie in signifikanten Bezugsgruppen (Familie, Freunde, Schulklasse) je nach<br />
deren sozialer und/oder ökonomischer Kompetenz moderiert, das heißt im Hinblick<br />
auf die Vermeidung einer kriminellen Entwicklung abgeschwächt oder verstärkt werden<br />
können. Darüber hinaus ist nicht bekannt, welche Bedeutung der subjektiven Bewertung<br />
eines Labels durch den Adressaten zukommt. So nimmt Sherman (1993, S.<br />
463) an, dass erst Sanktionierungen, die als ungerecht empfunden werden, delinquenzfördernde<br />
(sekundäre Devianz) Abwehr- oder Trotzreaktionen (Defiance) her<strong>vor</strong>rufen<br />
(ebenso Prein und Schumann 2003, S. 185, 215 f.).<br />
Neben solchen sozialpsychologischen Prozessen bleiben Effekte systemischer Eigendynamik<br />
freilich bestehen. Indem sich formelle Kontrollsysteme wiederholt auf<br />
ihre (im institutionalisierten Ermittlungs- und Sanktionierungsgedächtnis archivierten)<br />
<strong>vor</strong>herigen Entscheidungen beziehen, erhöht sich das Entdeckungs- und Sanktionierungsrisiko<br />
unabhängig von anderen persönlichen oder sozialen Faktoren. Hermann<br />
und Kerner (1988; siehe auch Kerner und Janssen 1996) kommen auf Grund von Analysen<br />
über den Verlauf der Rückfälligkeit von 500 Gefangenen, die 1960 aus zwei<br />
nordrhein-westfälischen Jugendstrafanstalten entlassen worden waren, zum Ergebnis,<br />
dass die Eigendynamik der Verurteilungen (also die „Justizkarriere“) für die Rückfallhäufigkeit<br />
wesentlich bedeutsamer ist als Sozialisations- oder Persönlichkeitsdefizite.<br />
Auch in einer an systemtheoretischen Überlegungen (zum Beispiel zur Selbstreferenz,<br />
Luhmann 1984, S. 57 ff.; siehe Boers 1997, S. 567 ff.) orientierten explorativen Ana-<br />
len(bereiche) Sanktionierung, Cliquenzugehörigkeit sowie <strong>vor</strong>herige selbstberichtete Delinquenz. –<br />
Auch in den Analysen der Denver-Studie fanden Huizinga et al. (2003, S. 81), dass polizeiliche Vernehmungen<br />
(Arrest) kaum abschreckend, sondern <strong>vor</strong>nehmlich verstärkend auf weiteres delinquentes<br />
Verhalten wirkten. Drei Viertel der Probanden, die erstmals polizeilich vernommen worden waren, unterschieden<br />
sich nicht oder berichteten nachfolgend mehr delinquentes Verhalten als eine ansonsten<br />
gleich strukturierte Kontrollgruppe.