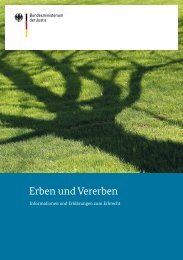Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
188<br />
HACI-HALIL USCULAN<br />
nach wie <strong>vor</strong> mangelnde Repräsentanz der kulturell-ethnischen Minderheiten im deutschen<br />
Bildungskanon und der deutschen Öffentlichkeit gerade den Aufbau eines positiven<br />
symbolischen Bezuges zur Herkunft erschweren.<br />
Problematisch an diesem Ansatz der bikulturellen Sozialisation bzw. des Kulturkonflikts<br />
ist aber die Annahme, dass die Ursache der Probleme von Migrantenkindern<br />
eindeutig auf den Kulturwechsel und der damit zusammenhängenden Konflikte zurück<br />
zu führen ist. Zweifellos sind die interkulturelle Situation und ihr Bezug zu zwei unterschiedlichen<br />
kulturellen Milieus wichtige Aspekte der spezifischen Situation von<br />
Migranten. Kulturkonflikt-Konzepte werden aber reduktionistisch, wenn „Kulturwechsel“<br />
einseitig als eine Entwicklungseinschränkung des Individuums betrachtet<br />
und zugleich nicht mit reflektiert wird, dass ein einseitiger Bezug auf die eigenen kulturellen<br />
Hintergründe in der Migrationssituation sowohl entwicklungshemmende als<br />
auch entwicklungsbegünstigende Seiten hat (Gontovos, 2000). Die ausschließliche<br />
Zentrierung auf die Veränderungen der Heimatkultur – im Zuge einer Assimilation –<br />
führt dazu, dass die familiären und extrafamiliären sowie die gesellschaftlichen Bedingungen<br />
des Migrationslandes nicht mit reflektiert werden. Die Ansätze der bikulturellen<br />
Sozialisation und des interkulturellen Austausches gehen von einer einseitigen<br />
Bereicherung der Einheimischen bzw. eines einseitigen Verlustes der Migranten aus,<br />
so dass das zugrundeliegende Anpassungs- bzw. Assimilationskonzept zu eng ist.<br />
Mit Berry, Poortinga, Segall und <strong>Das</strong>en (1992) läßt sich eher vermuten, dass die<br />
Qualität „ökologischer Übergänge“, denen Migrantenkinder und ihre Familien begegnen,<br />
wesentlich dadurch bestimmt ist, dass die Eltern das doppelte Verhältnis, einerseits<br />
zur eigenen Ethnie, andererseits zur Aufnahmegesellschaft, eigenaktiv gestalten<br />
müssen. Dabei lassen sich, Bourhis, Moise, Perreault & Senéca (1997) folgend, auf<br />
Seiten der Migranten in idealisierter Form vier Optionen unterscheiden: Integration,<br />
Assimilation, Separation und Marginalisierung. Während bei Integration und Assimilation<br />
Handlungsoptionen stärker auf die aufnehmende Gesellschaft bezogen sind,<br />
wobei Integration zugleich Bezüge zur Herkunftskultur bzw. zur eigenen Ethnie stärker<br />
berücksichtigt, ist Separation durch eine stärkere Abgrenzung zur aufnehmenden<br />
Gesellschaft bei gleichzeitiger Hinwendung zur eigenen Ethnie und schließlich Marginalisierung<br />
durch eine Abgrenzung sowohl von intra- als auch interethnischen Beziehungen<br />
gekennzeichnet, wobei Marginalisierung, wie Sackmann (2001) betont,<br />
auch als eine Folge frustrierten Assimilations- oder Integrationswunsches verstanden<br />
werden kann. Dabei können diese Optionen bereichsspezifisch variieren und bringen<br />
nicht nur Unterschiede in personenbezogenen Präferenzen zum Ausdruck, sondern<br />
hängen wesentlich von den Erfahrungen mit Handlungsopportunitäten und -barrieren<br />
in der Aufnahmegesellschaft zusammen. Empirische Befunde sprechen dafür, dass<br />
Marginalisation und Separation mit höheren Belastungen verbunden sind als Integration<br />
und Assimilation (Berry & Kim, 1988; Morgenroth & Merkens, 1997).<br />
Zugleich sind hier jedoch auch die dominanten Orientierungen bei den Vertretern<br />
der Aufnahmegesellschaft zu berücksichtigen: Integration liegt <strong>vor</strong>, wenn Mitglieder<br />
der Aufnahmegesellschaft Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber der Kultur der<br />
Migranten aufbringen und ihnen den Zugang zur Kultur des Aufnahmelandes erleichtern<br />
und die Übernahme ihrer eigenen kulturellen Muster begrüßen. Assimilationsorientierungen<br />
liegen <strong>vor</strong>, wenn die Mitglieder der Aufnahmegesellschaft von Migranten