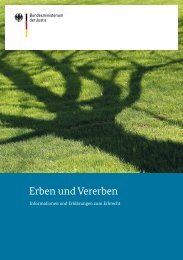Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Das Jugendkriminalrecht vor neuen Herausforderungen?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KONTINUITÄT UND ABBRUCH PERSISTENTER DELINQUENZVERLÄUFE 117<br />
Etwas deutlicher ausgeprägt erschien der Effekt von Persönlichkeitsfaktoren (<strong>vor</strong><br />
allem des HIA-Syndroms: Hyperactivity-Impulsivity-Attention-Deficit) in multivariaten<br />
Analysen der Pittsburgh-Studie hinsichtlich „Physical Aggression“ und „Multiple<br />
Problem Boys“ (Loeber et al. 1998, S. 192 ff., 243 ff.), nicht jedoch für die Gesamtdelinquenz<br />
(S. 114 ff.). Diese Analysen wurden allerdings nur im Kindesalter (alle drei<br />
Kohorten: 7, 11 und 14 Jahre) als Querschnittsanalyse des ersten so genannten Follow-Up<br />
durchgeführt. Sie konnten also die inhaltlich entscheidende weitere Entwicklung<br />
solcher Zusammenhänge, insbesondere mit Blick auf deren Stabilität oder Wandel<br />
(bei Letzterem <strong>vor</strong> allem den Abbruch im Rahmen des sog. Maturing-Out), nicht<br />
untersuchen. <strong>Das</strong> HIA-Syndrom erklärte allerdings auch hier lediglich zwischen 2%<br />
und 5% der Varianz dieser multifaktoriellen Modelle, die insgesamt bis zu 23% (Physical<br />
Aggression) bzw. 29% (Multiple Problem Boys) aufklären konnten (ebda.); 28 die<br />
Analyse der „Multiple Problem Boys“ ist zudem teilweise tautologisch erfolgt, da in<br />
die Konstruktion dieser abhängigen Variablen neben anderen Problemen auch ein<br />
ADHD-Score (Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder) eingegangen ist (a.a.O., S.<br />
241 f.). Bemerkenswerterweise entfiel jeweils die Hälfte der erklärten Varianz auf nur<br />
eine Variable: Lack of Guilt (a.a.O., S. 115, 193, 245 f.). Deren Validität ist indessen<br />
zweifelhaft. Denn entgegen der sonstigen Übung dieser Studie beruht diese Variable<br />
nicht auf einem mit zahlreichen Items erhobenen Index, sondern lediglich auf dieser<br />
einen, nur von den Eltern oder Lehrern beantworteten Frage (a.a.O., S. 60). Man kann<br />
angesichts dessen nicht ausschließen, dass die Befragten den „Mangel an Schuldgefühl“<br />
aus dem ihnen bekannten delinquenten Verhalten geschlossen haben, Ersteres<br />
also lediglich eine Näherungsvariable für Letzteres wäre. Zudem interpretieren Loeber<br />
et al. „Lack of Guilt“ als (anlagebedingte) Persönlichkeitseigenschaft. Man wird darin<br />
indessen eine im Rahmen des Sozialisationsprozesses erworbene normative Einstellung<br />
zu erblicken haben.<br />
<strong>Das</strong>s solche personalen Risikofaktoren für den delinquenten Lebensverlauf weniger<br />
relevant sind, zeigte sich auch in der Fortuntersuchung der Gluecks-Probanden durch<br />
Sampson und Laub (2003, S. 582 f.; Laub und Sampson 2003, S. 107 ff.). Die bereits<br />
zu<strong>vor</strong> beschriebenen lebenslangen Trajektorien konnten nämlich anhand von kindlichen<br />
und jugendlichen Risikofaktoren individueller oder familiärer Art (unter anderem<br />
renzperioden (Alter 13-18 bzw. 18-25 Jahre) und enthält kaum eines der üblichen Items zur Gewaltoder<br />
Eigentumsdelinquenz; mit 25 Jahren (t4) wurden zudem vier zusätzliche Delikte erfragt. Damit<br />
mag zusammenhängen, dass die Prävalenzraten mit 25 (unerwarteterweise) deutlich höher lagen als<br />
mit 18 Jahren (t3; Schmidt et al. 2001, S. 27 ff.). In den Auswertungen blieben die selbstberichteten<br />
Bagatelldelikte zwar unberücksichtigt, Eigentums- und Gewaltdelikte konnten jedoch nicht unterschieden<br />
werden. Des Weiteren ist nicht plausibel, warum in den multivariaten Analysen die Risikofaktoren<br />
des 13.-18. Lebensjahres, die auch zahlreiche soziale und ökonomische Belastungen enthielten,<br />
„aufgrund ihrer zeitlichen Nähe zum Vorhersagekriterium“ nicht berücksichtigt wurden, denn<br />
proximale Faktoren hatten ansonsten einen stärkeren Effekt (Lay et al. 2001, S. 125 ff., Fn. 2). Kriminologisch<br />
wäre bedeutsam, ob diese Faktoren bei ihrer Berücksichtigung einen noch deutlicheren Einfluss<br />
gewonnen hätten.<br />
28<br />
Bei der Gesamtdelinquenz betrug die erklärte Varianz zwischen 11% und 22% (Loeber et al. 1998, S.<br />
115). – Loeber und Kollegen berichten als multivariate Koeffizienten ihrer hierarchischen Regressionsanalysen<br />
die jeweils erreichte multiple Korrelation („Multiple R“). Um das Maß der jeweiligen erklärten<br />
Varianz (Determinationskoeffizient R²) zu erhalten, muss man diese quadrieren (Kühnel und<br />
Krebs 2001, S. 534).