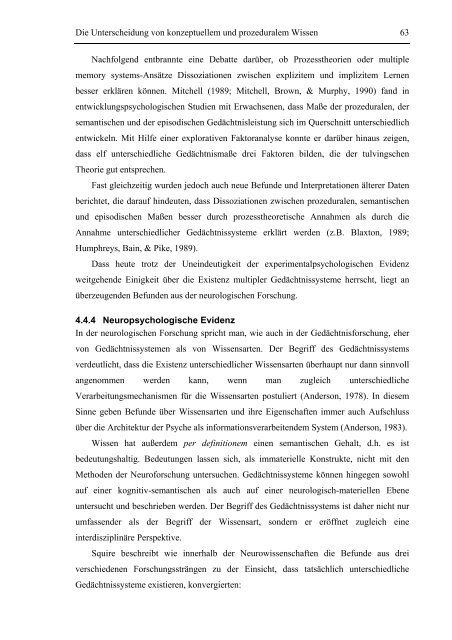Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Unterscheidung von konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong> 63<br />
Nachfolgend entbrannte eine Debatte darüber, ob Prozesstheorien oder multiple<br />
memory systems-Ansätze Dissoziationen zwischen explizitem <strong>und</strong> implizitem Lernen<br />
besser erklären können. Mitchell (1989; Mitchell, Brown, & Murphy, 1990) fand in<br />
entwicklungspsychologischen Studien mit Erwachsenen, dass Maße der prozeduralen, der<br />
semantischen <strong>und</strong> der episodischen Gedächtnisleistung sich im Querschnitt unterschiedlich<br />
entwickeln. Mit Hilfe einer explorativen Faktoranalyse konnte er darüber hinaus zeigen,<br />
dass elf unterschiedliche Gedächtnismaße drei Faktoren bilden, die der tulvingschen<br />
Theorie gut entsprechen.<br />
Fast gleichzeitig wurden jedoch auch neue Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Interpretationen älterer Daten<br />
berichtet, die darauf hindeuten, dass Dissoziationen zwischen prozeduralen, semantischen<br />
<strong>und</strong> episodischen Maßen besser durch prozesstheoretische Annahmen <strong>als</strong> durch die<br />
Annahme unterschiedlicher Gedächtnissysteme erklärt werden (z.B. Blaxton, 1989;<br />
Humphreys, Bain, & Pike, 1989).<br />
Dass heute trotz der Uneindeutigkeit der experimentalpsychologischen Evidenz<br />
weitgehende Einigkeit über die Existenz multipler Gedächtnissysteme herrscht, liegt an<br />
überzeugenden Bef<strong>und</strong>en aus der neurologischen Forschung.<br />
4.4.4 Neuropsychologische Evidenz<br />
In der neurologischen Forschung spricht man, wie auch in der Gedächtnisforschung, eher<br />
von Gedächtnissystemen <strong>als</strong> von <strong>Wissen</strong>sarten. Der Begriff des Gedächtnissystems<br />
verdeutlicht, dass die Existenz unterschiedlicher <strong>Wissen</strong>sarten überhaupt nur dann sinnvoll<br />
angenommen werden kann, wenn man zugleich unterschiedliche<br />
Verarbeitungsmechanismen für die <strong>Wissen</strong>sarten postuliert (Anderson, 1978). In diesem<br />
Sinne geben Bef<strong>und</strong>e über <strong>Wissen</strong>sarten <strong>und</strong> ihre Eigenschaften immer auch Aufschluss<br />
über die Architektur der Psyche <strong>als</strong> informationsverarbeitendem System (Anderson, 1983).<br />
<strong>Wissen</strong> hat außerdem per definitionem einen semantischen Gehalt, d.h. es ist<br />
bedeutungshaltig. Bedeutungen lassen sich, <strong>als</strong> immaterielle Konstrukte, nicht mit den<br />
Methoden der Neuroforschung untersuchen. Gedächtnissysteme können hingegen sowohl<br />
auf einer kognitiv-semantischen <strong>als</strong> auch auf einer neurologisch-materiellen Ebene<br />
untersucht <strong>und</strong> beschrieben werden. Der Begriff des Gedächtnissystems ist daher nicht nur<br />
umfassender <strong>als</strong> der Begriff der <strong>Wissen</strong>sart, sondern er eröffnet zugleich eine<br />
interdisziplinäre Perspektive.<br />
Squire beschreibt wie innerhalb der Neurowissenschaften die Bef<strong>und</strong>e aus drei<br />
verschiedenen Forschungssträngen zu der Einsicht, dass tatsächlich unterschiedliche<br />
Gedächtnissysteme existieren, konvergierten: