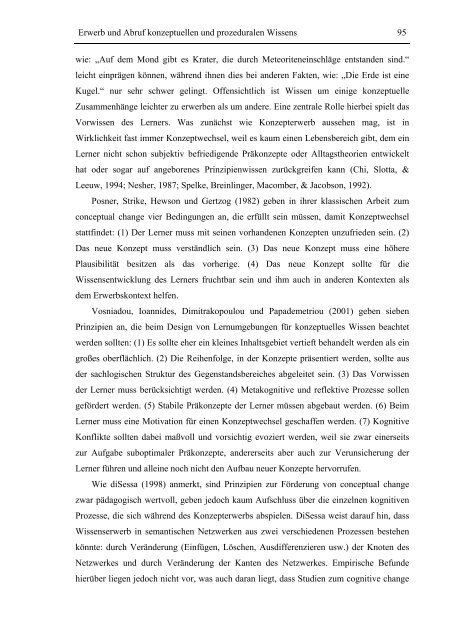Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erwerb <strong>und</strong> Abruf konzeptuellen <strong>und</strong> prozeduralen <strong>Wissen</strong>s 95<br />
wie: „Auf dem Mond gibt es Krater, die durch Meteoriteneinschläge entstanden sind.“<br />
leicht einprägen können, während ihnen dies bei anderen Fakten, wie: „Die Erde ist eine<br />
Kugel.“ nur sehr schwer gelingt. Offensichtlich ist <strong>Wissen</strong> um einige konzeptuelle<br />
Zusammenhänge leichter zu erwerben <strong>als</strong> um andere. Eine zentrale Rolle hierbei spielt das<br />
Vorwissen des Lerners. Was zunächst wie Konzepterwerb aussehen mag, ist in<br />
Wirklichkeit fast immer Konzeptwechsel, weil es kaum einen Lebensbereich gibt, dem ein<br />
Lerner nicht schon subjektiv befriedigende Präkonzepte oder Alltagstheorien entwickelt<br />
hat oder sogar auf angeborenes Prinzipienwissen zurückgreifen kann (Chi, Slotta, &<br />
Leeuw, 1994; Nesher, 1987; Spelke, Breinlinger, Macomber, & Jacobson, 1992).<br />
Posner, Strike, Hewson <strong>und</strong> Gertzog (1982) geben in ihrer klassischen Arbeit zum<br />
conceptual change vier Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit Konzeptwechsel<br />
stattfindet: (1) Der Lerner muss mit seinen vorhandenen Konzepten unzufrieden sein. (2)<br />
Das neue Konzept muss verständlich sein. (3) Das neue Konzept muss eine höhere<br />
Plausibilität besitzen <strong>als</strong> das vorherige. (4) Das neue Konzept sollte für die<br />
<strong>Wissen</strong>sentwicklung des Lerners fruchtbar sein <strong>und</strong> ihm auch in anderen Kontexten <strong>als</strong><br />
dem Erwerbskontext helfen.<br />
Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou <strong>und</strong> Papademetriou (2001) geben sieben<br />
Prinzipien an, die beim Design von Lernumgebungen für konzeptuelles <strong>Wissen</strong> beachtet<br />
werden sollten: (1) Es sollte eher ein kleines Inhaltsgebiet vertieft behandelt werden <strong>als</strong> ein<br />
großes oberflächlich. (2) Die Reihenfolge, in der Konzepte präsentiert werden, sollte aus<br />
der sachlogischen Struktur des Gegenstandsbereiches abgeleitet sein. (3) Das Vorwissen<br />
der Lerner muss berücksichtigt werden. (4) Metakognitive <strong>und</strong> reflektive Prozesse sollen<br />
gefördert werden. (5) Stabile Präkonzepte der Lerner müssen abgebaut werden. (6) Beim<br />
Lerner muss eine Motivation für einen Konzeptwechsel geschaffen werden. (7) Kognitive<br />
Konflikte sollten dabei maßvoll <strong>und</strong> vorsichtig evoziert werden, weil sie zwar einerseits<br />
zur Aufgabe suboptimaler Präkonzepte, andererseits aber auch zur Verunsicherung der<br />
Lerner führen <strong>und</strong> alleine noch nicht den Aufbau neuer Konzepte hervorrufen.<br />
Wie diSessa (1998) anmerkt, sind Prinzipien zur Förderung von conceptual change<br />
zwar pädagogisch wertvoll, geben jedoch kaum Aufschluss über die einzelnen kognitiven<br />
Prozesse, die sich während des Konzepterwerbs abspielen. DiSessa weist darauf hin, dass<br />
<strong>Wissen</strong>serwerb in semantischen Netzwerken aus zwei verschiedenen Prozessen bestehen<br />
könnte: durch Veränderung (Einfügen, Löschen, Ausdifferenzieren usw.) der Knoten des<br />
Netzwerkes <strong>und</strong> durch Veränderung der Kanten des Netzwerkes. Empirische Bef<strong>und</strong>e<br />
hierüber liegen jedoch nicht vor, was auch daran liegt, dass Studien zum cognitive change