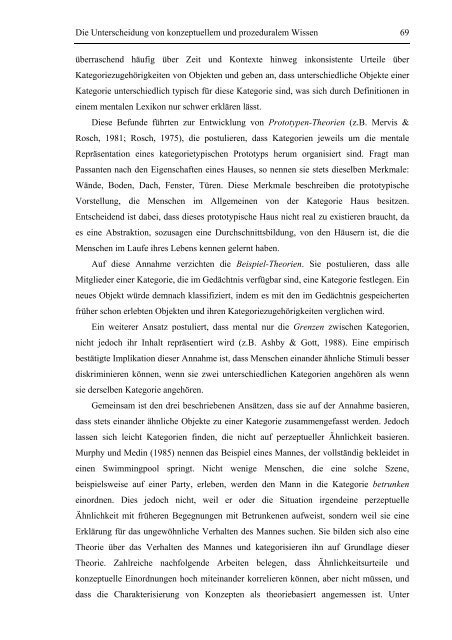Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Unterscheidung von konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong> 69<br />
überraschend häufig über Zeit <strong>und</strong> Kontexte hinweg inkonsistente Urteile über<br />
Kategoriezugehörigkeiten von Objekten <strong>und</strong> geben an, dass unterschiedliche Objekte einer<br />
Kategorie unterschiedlich typisch für diese Kategorie sind, was sich durch Definitionen in<br />
einem mentalen Lexikon nur schwer erklären lässt.<br />
Diese Bef<strong>und</strong>e führten zur Entwicklung von Prototypen-Theorien (z.B. Mervis &<br />
Rosch, 1981; Rosch, 1975), die postulieren, dass Kategorien jeweils um die mentale<br />
Repräsentation eines kategorietypischen Prototyps herum organisiert sind. Fragt man<br />
Passanten nach den Eigenschaften eines Hauses, so nennen sie stets dieselben Merkmale:<br />
Wände, Boden, Dach, Fenster, Türen. Diese Merkmale beschreiben die prototypische<br />
Vorstellung, die Menschen im Allgemeinen von der Kategorie Haus besitzen.<br />
Entscheidend ist dabei, dass dieses prototypische Haus nicht real zu existieren braucht, da<br />
es eine Abstraktion, sozusagen eine Durchschnittsbildung, von den Häusern ist, die die<br />
Menschen im Laufe ihres Lebens kennen gelernt haben.<br />
Auf diese Annahme verzichten die Beispiel-Theorien. Sie postulieren, dass alle<br />
Mitglieder einer Kategorie, die im Gedächtnis verfügbar sind, eine Kategorie festlegen. Ein<br />
neues Objekt würde demnach klassifiziert, indem es mit den im Gedächtnis gespeicherten<br />
früher schon erlebten Objekten <strong>und</strong> ihren Kategoriezugehörigkeiten verglichen wird.<br />
Ein weiterer Ansatz postuliert, dass mental nur die Grenzen zwischen Kategorien,<br />
nicht jedoch ihr Inhalt repräsentiert wird (z.B. Ashby & Gott, 1988). Eine empirisch<br />
bestätigte Implikation dieser Annahme ist, dass Menschen einander ähnliche Stimuli besser<br />
diskriminieren können, wenn sie zwei unterschiedlichen Kategorien angehören <strong>als</strong> wenn<br />
sie derselben Kategorie angehören.<br />
Gemeinsam ist den drei beschriebenen Ansätzen, dass sie auf der Annahme basieren,<br />
dass stets einander ähnliche Objekte zu einer Kategorie zusammengefasst werden. Jedoch<br />
lassen sich leicht Kategorien finden, die nicht auf perzeptueller Ähnlichkeit basieren.<br />
Murphy <strong>und</strong> Medin (1985) nennen das Beispiel eines Mannes, der vollständig bekleidet in<br />
einen Swimmingpool springt. Nicht wenige Menschen, die eine solche Szene,<br />
beispielsweise auf einer Party, erleben, werden den Mann in die Kategorie betrunken<br />
einordnen. Dies jedoch nicht, weil er oder die Situation irgendeine perzeptuelle<br />
Ähnlichkeit mit früheren Begegnungen mit Betrunkenen aufweist, sondern weil sie eine<br />
Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten des Mannes suchen. Sie bilden sich <strong>als</strong>o eine<br />
Theorie über das Verhalten des Mannes <strong>und</strong> kategorisieren ihn auf Gr<strong>und</strong>lage dieser<br />
Theorie. Zahlreiche nachfolgende Arbeiten belegen, dass Ähnlichkeitsurteile <strong>und</strong><br />
konzeptuelle Einordnungen hoch miteinander korrelieren können, aber nicht müssen, <strong>und</strong><br />
dass die Charakterisierung von Konzepten <strong>als</strong> theoriebasiert angemessen ist. Unter