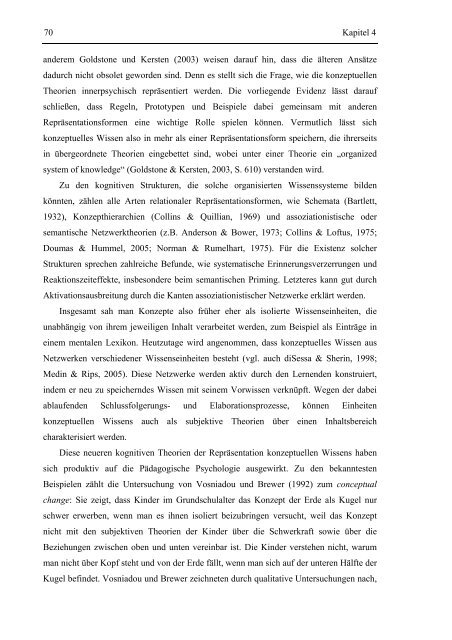Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
70 Kapitel 4<br />
anderem Goldstone <strong>und</strong> Kersten (2003) weisen darauf hin, dass die älteren Ansätze<br />
dadurch nicht obsolet geworden sind. Denn es stellt sich die Frage, wie die konzeptuellen<br />
Theorien innerpsychisch repräsentiert werden. Die vorliegende Evidenz lässt darauf<br />
schließen, dass Regeln, Prototypen <strong>und</strong> Beispiele dabei gemeinsam mit anderen<br />
Repräsentationsformen eine wichtige Rolle spielen können. Vermutlich lässt sich<br />
konzeptuelles <strong>Wissen</strong> <strong>als</strong>o in mehr <strong>als</strong> einer Repräsentationsform speichern, die ihrerseits<br />
in übergeordnete Theorien eingebettet sind, wobei unter einer Theorie ein „organized<br />
system of knowledge“ (Goldstone & Kersten, 2003, S. 610) verstanden wird.<br />
Zu den kognitiven Strukturen, die solche organisierten <strong>Wissen</strong>ssysteme bilden<br />
könnten, zählen alle Arten relationaler Repräsentationsformen, wie Schemata (Bartlett,<br />
1932), Konzepthierarchien (Collins & Quillian, 1969) <strong>und</strong> assoziationistische oder<br />
semantische Netzwerktheorien (z.B. Anderson & Bower, 1973; Collins & Loftus, 1975;<br />
Doumas & Hummel, 2005; Norman & Rumelhart, 1975). Für die Existenz solcher<br />
Strukturen sprechen zahlreiche Bef<strong>und</strong>e, wie systematische Erinnerungsverzerrungen <strong>und</strong><br />
Reaktionszeiteffekte, insbesondere beim semantischen Priming. Letzteres kann gut durch<br />
Aktivationsausbreitung durch die Kanten assoziationistischer Netzwerke erklärt werden.<br />
Insgesamt sah man Konzepte <strong>als</strong>o früher eher <strong>als</strong> isolierte <strong>Wissen</strong>seinheiten, die<br />
unabhängig von ihrem jeweiligen Inhalt verarbeitet werden, zum Beispiel <strong>als</strong> Einträge in<br />
einem mentalen Lexikon. Heutzutage wird angenommen, dass konzeptuelles <strong>Wissen</strong> aus<br />
Netzwerken verschiedener <strong>Wissen</strong>seinheiten besteht (vgl. auch diSessa & Sherin, 1998;<br />
Medin & Rips, 2005). Diese Netzwerke werden aktiv durch den Lernenden konstruiert,<br />
indem er neu zu speicherndes <strong>Wissen</strong> mit seinem Vorwissen verknüpft. Wegen der dabei<br />
ablaufenden Schlussfolgerungs- <strong>und</strong> Elaborationsprozesse, können Einheiten<br />
konzeptuellen <strong>Wissen</strong>s auch <strong>als</strong> subjektive Theorien über einen Inhaltsbereich<br />
charakterisiert werden.<br />
Diese neueren kognitiven Theorien der Repräsentation konzeptuellen <strong>Wissen</strong>s haben<br />
sich produktiv auf die Pädagogische Psychologie ausgewirkt. Zu den bekanntesten<br />
Beispielen zählt die Untersuchung von Vosniadou <strong>und</strong> Brewer (1992) zum conceptual<br />
change: Sie zeigt, dass Kinder im Gr<strong>und</strong>schulalter das Konzept der Erde <strong>als</strong> Kugel nur<br />
schwer erwerben, wenn man es ihnen isoliert beizubringen versucht, weil das Konzept<br />
nicht mit den subjektiven Theorien der Kinder über die Schwerkraft sowie über die<br />
Beziehungen zwischen oben <strong>und</strong> unten vereinbar ist. Die Kinder verstehen nicht, warum<br />
man nicht über Kopf steht <strong>und</strong> von der Erde fällt, wenn man sich auf der unteren Hälfte der<br />
Kugel befindet. Vosniadou <strong>und</strong> Brewer zeichneten durch qualitative Untersuchungen nach,