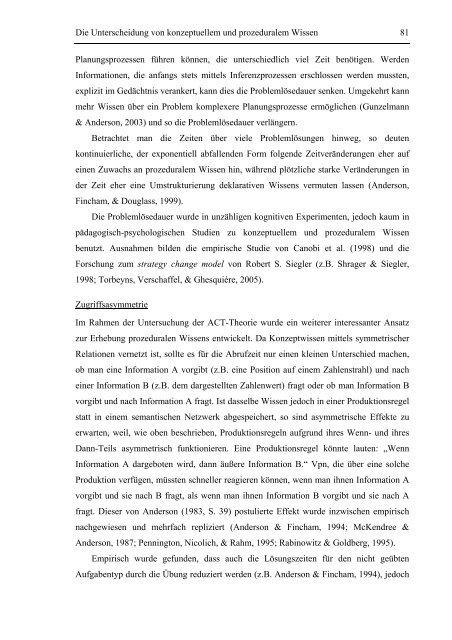Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Unterscheidung von konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong> 81<br />
Planungsprozessen führen können, die unterschiedlich viel Zeit benötigen. Werden<br />
Informationen, die anfangs stets mittels Inferenzprozessen erschlossen werden mussten,<br />
explizit im Gedächtnis verankert, kann dies die Problemlösedauer senken. Umgekehrt kann<br />
mehr <strong>Wissen</strong> über ein Problem komplexere Planungsprozesse ermöglichen (Gunzelmann<br />
& Anderson, 2003) <strong>und</strong> so die Problemlösedauer verlängern.<br />
Betrachtet man die Zeiten über viele Problemlösungen hinweg, so deuten<br />
kontinuierliche, der exponentiell abfallenden Form folgende Zeitveränderungen eher auf<br />
einen Zuwachs an prozeduralem <strong>Wissen</strong> hin, während plötzliche starke Veränderungen in<br />
der Zeit eher eine Umstrukturierung deklarativen <strong>Wissen</strong>s vermuten lassen (Anderson,<br />
Fincham, & Douglass, 1999).<br />
Die Problemlösedauer wurde in unzähligen kognitiven Experimenten, jedoch kaum in<br />
pädagogisch-psychologischen Studien zu konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong><br />
benutzt. Ausnahmen bilden die empirische Studie von Canobi et al. (1998) <strong>und</strong> die<br />
Forschung zum strategy change model von Robert S. Siegler (z.B. Shrager & Siegler,<br />
1998; Torbeyns, Verschaffel, & Ghesquiére, 2005).<br />
Zugriffsasymmetrie<br />
Im Rahmen der Untersuchung der ACT-Theorie wurde ein weiterer interessanter Ansatz<br />
zur Erhebung prozeduralen <strong>Wissen</strong>s entwickelt. Da Konzeptwissen mittels symmetrischer<br />
Relationen vernetzt ist, sollte es für die Abrufzeit nur einen kleinen Unterschied machen,<br />
ob man eine Information A vorgibt (z.B. eine Position auf einem Zahlenstrahl) <strong>und</strong> nach<br />
einer Information B (z.B. dem dargestellten Zahlenwert) fragt oder ob man Information B<br />
vorgibt <strong>und</strong> nach Information A fragt. Ist dasselbe <strong>Wissen</strong> jedoch in einer Produktionsregel<br />
statt in einem semantischen Netzwerk abgespeichert, so sind asymmetrische Effekte zu<br />
erwarten, weil, wie oben beschrieben, Produktionsregeln aufgr<strong>und</strong> ihres Wenn- <strong>und</strong> ihres<br />
Dann-Teils asymmetrisch funktionieren. Eine Produktionsregel könnte lauten: „Wenn<br />
Information A dargeboten wird, dann äußere Information B.“ Vpn, die über eine solche<br />
Produktion verfügen, müssten schneller reagieren können, wenn man ihnen Information A<br />
vorgibt <strong>und</strong> sie nach B fragt, <strong>als</strong> wenn man ihnen Information B vorgibt <strong>und</strong> sie nach A<br />
fragt. Dieser von Anderson (1983, S. 39) postulierte Effekt wurde inzwischen empirisch<br />
nachgewiesen <strong>und</strong> mehrfach repliziert (Anderson & Fincham, 1994; McKendree &<br />
Anderson, 1987; Pennington, Nicolich, & Rahm, 1995; Rabinowitz & Goldberg, 1995).<br />
Empirisch wurde gef<strong>und</strong>en, dass auch die Lösungszeiten für den nicht geübten<br />
Aufgabentyp durch die Übung reduziert werden (z.B. Anderson & Fincham, 1994), jedoch