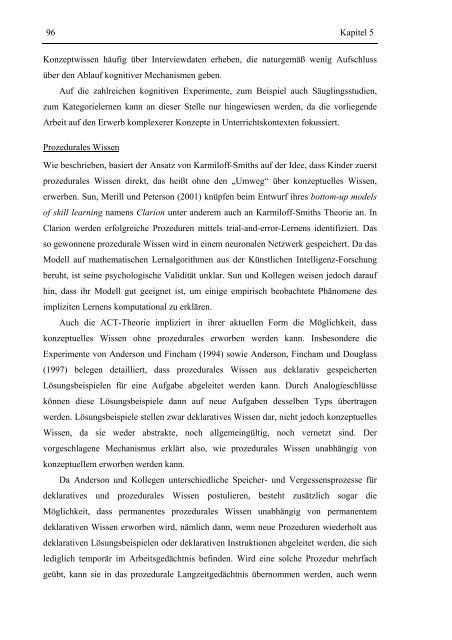Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
96 Kapitel 5<br />
Konzeptwissen häufig über Interviewdaten erheben, die naturgemäß wenig Aufschluss<br />
über den Ablauf kognitiver Mechanismen geben.<br />
Auf die zahlreichen kognitiven Experimente, zum Beispiel auch Säuglingsstudien,<br />
zum Kategorielernen kann an dieser Stelle nur hingewiesen werden, da die vorliegende<br />
Arbeit auf den Erwerb komplexerer Konzepte in Unterrichtskontexten fokussiert.<br />
Prozedurales <strong>Wissen</strong><br />
Wie beschrieben, basiert der Ansatz von Karmiloff-Smiths auf der Idee, dass Kinder zuerst<br />
<strong>prozedurales</strong> <strong>Wissen</strong> direkt, das heißt ohne den „Umweg“ über konzeptuelles <strong>Wissen</strong>,<br />
erwerben. Sun, Merill <strong>und</strong> Peterson (2001) knüpfen beim Entwurf ihres bottom-up models<br />
of skill learning namens Clarion unter anderem auch an Karmiloff-Smiths Theorie an. In<br />
Clarion werden erfolgreiche Prozeduren mittels trial-and-error-Lernens identifiziert. Das<br />
so gewonnene prozedurale <strong>Wissen</strong> wird in einem neuronalen Netzwerk gespeichert. Da das<br />
Modell auf mathematischen Lernalgorithmen aus der Künstlichen Intelligenz-Forschung<br />
beruht, ist seine psychologische Validität unklar. Sun <strong>und</strong> Kollegen weisen jedoch darauf<br />
hin, dass ihr Modell gut geeignet ist, um einige empirisch beobachtete Phänomene des<br />
impliziten Lernens komputational zu erklären.<br />
Auch die ACT-Theorie impliziert in ihrer aktuellen Form die Möglichkeit, dass<br />
konzeptuelles <strong>Wissen</strong> ohne <strong>prozedurales</strong> erworben werden kann. Insbesondere die<br />
Experimente von Anderson <strong>und</strong> Fincham (1994) sowie Anderson, Fincham <strong>und</strong> Douglass<br />
(1997) belegen detailliert, dass <strong>prozedurales</strong> <strong>Wissen</strong> aus deklarativ gespeicherten<br />
Lösungsbeispielen für eine Aufgabe abgeleitet werden kann. Durch Analogieschlüsse<br />
können diese Lösungsbeispiele dann auf neue Aufgaben desselben Typs übertragen<br />
werden. Lösungsbeispiele stellen zwar deklaratives <strong>Wissen</strong> dar, nicht jedoch konzeptuelles<br />
<strong>Wissen</strong>, da sie weder abstrakte, noch allgemeingültig, noch vernetzt sind. Der<br />
vorgeschlagene Mechanismus erklärt <strong>als</strong>o, wie <strong>prozedurales</strong> <strong>Wissen</strong> unabhängig von<br />
konzeptuellem erworben werden kann.<br />
Da Anderson <strong>und</strong> Kollegen unterschiedliche Speicher- <strong>und</strong> Vergessensprozesse für<br />
deklaratives <strong>und</strong> <strong>prozedurales</strong> <strong>Wissen</strong> postulieren, besteht zusätzlich sogar die<br />
Möglichkeit, dass permanentes <strong>prozedurales</strong> <strong>Wissen</strong> unabhängig von permanentem<br />
deklarativen <strong>Wissen</strong> erworben wird, nämlich dann, wenn neue Prozeduren wiederholt aus<br />
deklarativen Lösungsbeispielen oder deklarativen Instruktionen abgeleitet werden, die sich<br />
lediglich temporär im Arbeitsgedächtnis befinden. Wird eine solche Prozedur mehrfach<br />
geübt, kann sie in das prozedurale Langzeitgedächtnis übernommen werden, auch wenn