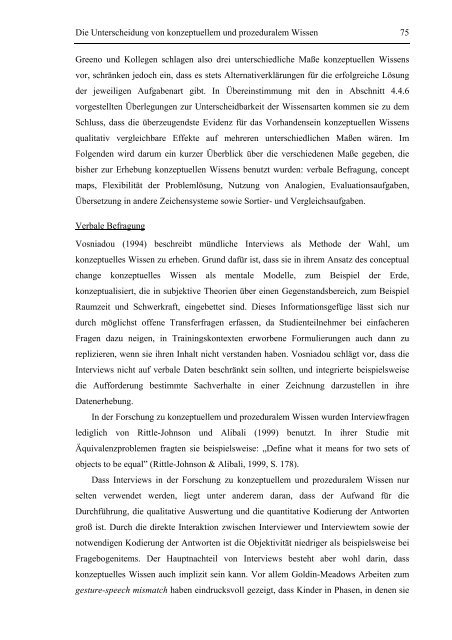Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Konzeptuelles und prozedurales Wissen als latente Variablen: Ihre ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Unterscheidung von konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong> 75<br />
Greeno <strong>und</strong> Kollegen schlagen <strong>als</strong>o drei unterschiedliche Maße konzeptuellen <strong>Wissen</strong>s<br />
vor, schränken jedoch ein, dass es stets Alternativerklärungen für die erfolgreiche Lösung<br />
der jeweiligen Aufgabenart gibt. In Übereinstimmung mit den in Abschnitt 4.4.6<br />
vorgestellten Überlegungen zur Unterscheidbarkeit der <strong>Wissen</strong>sarten kommen sie zu dem<br />
Schluss, dass die überzeugendste Evidenz für das Vorhandensein konzeptuellen <strong>Wissen</strong>s<br />
qualitativ vergleichbare Effekte auf mehreren unterschiedlichen Maßen wären. Im<br />
Folgenden wird darum ein kurzer Überblick über die verschiedenen Maße gegeben, die<br />
bisher zur Erhebung konzeptuellen <strong>Wissen</strong>s benutzt wurden: verbale Befragung, concept<br />
maps, Flexibilität der Problemlösung, Nutzung von Analogien, Evaluationsaufgaben,<br />
Übersetzung in andere Zeichensysteme sowie Sortier- <strong>und</strong> Vergleichsaufgaben.<br />
Verbale Befragung<br />
Vosniadou (1994) beschreibt mündliche Interviews <strong>als</strong> Methode der Wahl, um<br />
konzeptuelles <strong>Wissen</strong> zu erheben. Gr<strong>und</strong> dafür ist, dass sie in ihrem Ansatz des conceptual<br />
change konzeptuelles <strong>Wissen</strong> <strong>als</strong> mentale Modelle, zum Beispiel der Erde,<br />
konzeptualisiert, die in subjektive Theorien über einen Gegenstandsbereich, zum Beispiel<br />
Raumzeit <strong>und</strong> Schwerkraft, eingebettet sind. Dieses Informationsgefüge lässt sich nur<br />
durch möglichst offene Transferfragen erfassen, da Studienteilnehmer bei einfacheren<br />
Fragen dazu neigen, in Trainingskontexten erworbene Formulierungen auch dann zu<br />
replizieren, wenn sie ihren Inhalt nicht verstanden haben. Vosniadou schlägt vor, dass die<br />
Interviews nicht auf verbale Daten beschränkt sein sollten, <strong>und</strong> integrierte beispielsweise<br />
die Aufforderung bestimmte Sachverhalte in einer Zeichnung darzustellen in ihre<br />
Datenerhebung.<br />
In der Forschung zu konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong> wurden Interviewfragen<br />
lediglich von Rittle-Johnson <strong>und</strong> Alibali (1999) benutzt. In ihrer Studie mit<br />
Äquivalenzproblemen fragten sie beispielsweise: „Define what it means for two sets of<br />
objects to be equal” (Rittle-Johnson & Alibali, 1999, S. 178).<br />
Dass Interviews in der Forschung zu konzeptuellem <strong>und</strong> prozeduralem <strong>Wissen</strong> nur<br />
selten verwendet werden, liegt unter anderem daran, dass der Aufwand für die<br />
Durchführung, die qualitative Auswertung <strong>und</strong> die quantitative Kodierung der Antworten<br />
groß ist. Durch die direkte Interaktion zwischen Interviewer <strong>und</strong> Interviewtem sowie der<br />
notwendigen Kodierung der Antworten ist die Objektivität niedriger <strong>als</strong> beispielsweise bei<br />
Fragebogenitems. Der Hauptnachteil von Interviews besteht aber wohl darin, dass<br />
konzeptuelles <strong>Wissen</strong> auch implizit sein kann. Vor allem Goldin-Meadows Arbeiten zum<br />
gesture-speech mismatch haben eindrucksvoll gezeigt, dass Kinder in Phasen, in denen sie