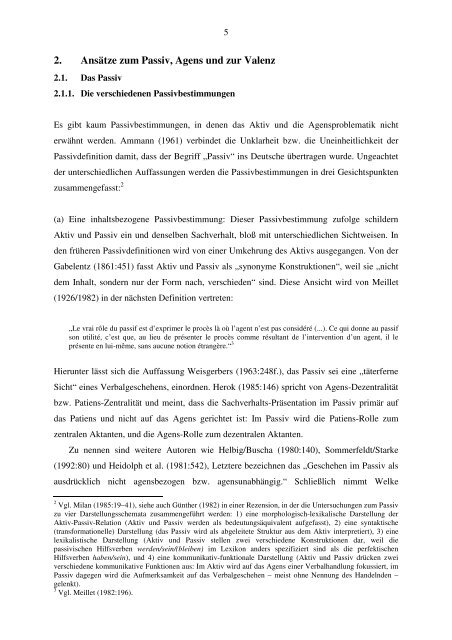Diss_16 Okt 2006 finalvers
Diss_16 Okt 2006 finalvers
Diss_16 Okt 2006 finalvers
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5<br />
2. Ansätze zum Passiv, Agens und zur Valenz<br />
2.1. Das Passiv<br />
2.1.1. Die verschiedenen Passivbestimmungen<br />
Es gibt kaum Passivbestimmungen, in denen das Aktiv und die Agensproblematik nicht<br />
erwähnt werden. Ammann (1961) verbindet die Unklarheit bzw. die Uneinheitlichkeit der<br />
Passivdefinition damit, dass der Begriff „Passiv“ ins Deutsche übertragen wurde. Ungeachtet<br />
der unterschiedlichen Auffassungen werden die Passivbestimmungen in drei Gesichtspunkten<br />
zusammengefasst: 2<br />
(a) Eine inhaltsbezogene Passivbestimmung: Dieser Passivbestimmung zufolge schildern<br />
Aktiv und Passiv ein und denselben Sachverhalt, bloß mit unterschiedlichen Sichtweisen. In<br />
den früheren Passivdefinitionen wird von einer Umkehrung des Aktivs ausgegangen. Von der<br />
Gabelentz (1861:451) fasst Aktiv und Passiv als „synonyme Konstruktionen“, weil sie „nicht<br />
dem Inhalt, sondern nur der Form nach, verschieden“ sind. Diese Ansicht wird von Meillet<br />
(1926/1982) in der nächsten Definition vertreten:<br />
„Le vrai rôle du passif est d’exprimer le procès là où l’agent n’est pas considéré (...). Ce qui donne au passif<br />
son utilité, c’est que, au lieu de présenter le procès comme résultant de l’intervention d’un agent, il le<br />
présente en lui-même, sans aucune notion étrangère.“ 3<br />
Hierunter lässt sich die Auffassung Weisgerbers (1963:248f.), das Passiv sei eine „täterferne<br />
Sicht“ eines Verbalgeschehens, einordnen. Herok (1985:146) spricht von Agens-Dezentralität<br />
bzw. Patiens-Zentralität und meint, dass die Sachverhalts-Präsentation im Passiv primär auf<br />
das Patiens und nicht auf das Agens gerichtet ist: Im Passiv wird die Patiens-Rolle zum<br />
zentralen Aktanten, und die Agens-Rolle zum dezentralen Aktanten.<br />
Zu nennen sind weitere Autoren wie Helbig/Buscha (1980:140), Sommerfeldt/Starke<br />
(1992:80) und Heidolph et al. (1981:542), Letztere bezeichnen das „Geschehen im Passiv als<br />
ausdrücklich nicht agensbezogen bzw. agensunabhängig.“ Schließlich nimmt Welke<br />
2 Vgl. Milan (1985:19–41), siehe auch Günther (1982) in einer Rezension, in der die Untersuchungen zum Passiv<br />
zu vier Darstellungsschemata zusammengeführt werden: 1) eine morphologisch-lexikalische Darstellung der<br />
Aktiv-Passiv-Relation (Aktiv und Passiv werden als bedeutungsäquivalent aufgefasst), 2) eine syntaktische<br />
(transformationelle) Darstellung (das Passiv wird als abgeleitete Struktur aus dem Aktiv interpretiert), 3) eine<br />
lexikalistische Darstellung (Aktiv und Passiv stellen zwei verschiedene Konstruktionen dar, weil die<br />
passivischen Hilfsverben werden/sein/(bleiben) im Lexikon anders spezifiziert sind als die perfektischen<br />
Hilfsverben haben/sein), und 4) eine kommunikativ-funktionale Darstellung (Aktiv und Passiv drücken zwei<br />
verschiedene kommunikative Funktionen aus: Im Aktiv wird auf das Agens einer Verbalhandlung fokussiert, im<br />
Passiv dagegen wird die Aufmerksamkeit auf das Verbalgeschehen – meist ohne Nennung des Handelnden –<br />
gelenkt).<br />
3 Vgl. Meillet (1982:196).