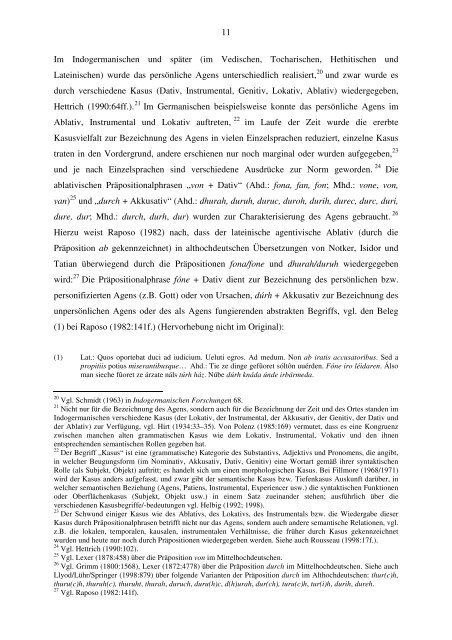Diss_16 Okt 2006 finalvers
Diss_16 Okt 2006 finalvers
Diss_16 Okt 2006 finalvers
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11<br />
Im Indogermanischen und später (im Vedischen, Tocharischen, Hethitischen und<br />
Lateinischen) wurde das persönliche Agens unterschiedlich realisiert, 20 und zwar wurde es<br />
durch verschiedene Kasus (Dativ, Instrumental, Genitiv, Lokativ, Ablativ) wiedergegeben,<br />
Hettrich (1990:64ff.). 21 Im Germanischen beispielsweise konnte das persönliche Agens im<br />
Ablativ, Instrumental und Lokativ auftreten, 22 im Laufe der Zeit wurde die ererbte<br />
Kasusvielfalt zur Bezeichnung des Agens in vielen Einzelsprachen reduziert, einzelne Kasus<br />
traten in den Vordergrund, andere erschienen nur noch marginal oder wurden aufgegeben, 23<br />
und je nach Einzelsprachen sind verschiedene Ausdrücke zur Norm geworden. 24 Die<br />
ablativischen Präpositionalphrasen „von + Dativ“ (Ahd.: fona, fan, fon; Mhd.: vone, von,<br />
van) 25 und „durch + Akkusativ“ (Ahd.: dhurah, duruh, duruc, duroh, durih, durec, durc, duri,<br />
dure, dur; Mhd.: durch, durh, dur) wurden zur Charakterisierung des Agens gebraucht. 26<br />
Hierzu weist Raposo (1982) nach, dass der lateinische agentivische Ablativ (durch die<br />
Präposition ab gekennzeichnet) in althochdeutschen Übersetzungen von Notker, Isidor und<br />
Tatian überwiegend durch die Präpositionen fona/fone und dhurah/duruh wiedergegeben<br />
wird: 27 Die Präpositionalphrase fóne + Dativ dient zur Bezeichnung des persönlichen bzw.<br />
personifizierten Agens (z.B. Gott) oder von Ursachen, dúrh + Akkusativ zur Bezeichnung des<br />
unpersönlichen Agens oder des als Agens fungierenden abstrakten Begriffs, vgl. den Beleg<br />
(1) bei Raposo (1982:141f.) (Hervorhebung nicht im Original):<br />
(1) Lat.: Quos oportebat duci ad iudicium. Ueluti egros. Ad medum. Non ab iratis accusatoribus. Sed a<br />
propitiis potius miserantibusque… Ahd.: Tie ze dinge gefûoret sóltôn uuérden. Fóne iro léidaren. Álso<br />
man sieche fûoret ze árzate náls túrh ház. Núbe dúrh knáda únde irbármeda.<br />
20 Vgl. Schmidt (1963) in Indogermanischen Forschungen 68.<br />
21 Nicht nur für die Bezeichnung des Agens, sondern auch für die Bezeichnung der Zeit und des Ortes standen im<br />
Indogermanischen verschiedene Kasus (der Lokativ, der Instrumental, der Akkusativ, der Genitiv, der Dativ und<br />
der Ablativ) zur Verfügung, vgl. Hirt (1934:33–35). Von Polenz (1985:<strong>16</strong>9) vermutet, dass es eine Kongruenz<br />
zwischen manchen alten grammatischen Kasus wie dem Lokativ, Instrumental, Vokativ und den ihnen<br />
entsprechenden semantischen Rollen gegeben hat.<br />
22 Der Begriff „Kasus“ ist eine (grammatische) Kategorie des Substantivs, Adjektivs und Pronomens, die angibt,<br />
in welcher Beugungsform (im Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) eine Wortart gemäß ihrer syntaktischen<br />
Rolle (als Subjekt, Objekt) auftritt; es handelt sich um einen morphologischen Kasus. Bei Fillmore (1968/1971)<br />
wird der Kasus anders aufgefasst, und zwar gibt der semantische Kasus bzw. Tiefenkasus Auskunft darüber, in<br />
welcher semantischen Beziehung (Agens, Patiens, Instrumental, Experiencer usw.) die syntaktischen Funktionen<br />
oder Oberflächenkasus (Subjekt, Objekt usw.) in einem Satz zueinander stehen; ausführlich über die<br />
verschiedenen Kasusbegriffe/-bedeutungen vgl. Helbig (1992; 1998).<br />
23 Der Schwund einiger Kasus wie des Ablativs, des Lokativs, des Instrumentals bzw. die Wiedergabe dieser<br />
Kasus durch Präpositionalphrasen betrifft nicht nur das Agens, sondern auch andere semantische Relationen, vgl.<br />
z.B. die lokalen, temporalen, kausalen, instrumentalen Verhältnisse, die früher durch Kasus gekennzeichnet<br />
wurden und heute nur noch durch Präpositionen wiedergegeben werden. Siehe auch Rousseau (1998:17f.).<br />
24 Vgl. Hettrich (1990:102).<br />
25 Vgl. Lexer (1878:458) über die Präposition von im Mittelhochdeutschen.<br />
26 Vgl. Grimm (1800:1568), Lexer (1872:4778) über die Präposition durch im Mittelhochdeutschen. Siehe auch<br />
Llyod/Lühr/Springer (1998:879) über folgende Varianten der Präposition durch im Althochdeutschen: thur(c)h,<br />
thuru(c)h, thuruh(c), thuruht, thurah, duruch, duru(h)c, d(h)urah, dur(ch), turu(c)h, tur(i)h, durih, dureh.<br />
27 Vgl. Raposo (1982:141f).