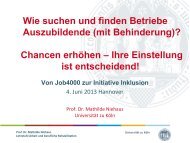Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Endbericht: <strong>Aktualisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Berichterstattung</strong> <strong>über</strong> <strong>die</strong> <strong>Verteilung</strong> von Einkommen und Vermögen 172<br />
Der empirische Ansatz <strong>der</strong> „integrierten Analyse von Einkommen und Vermögen“ besteht darin, <strong>die</strong><br />
Bestandsgröße Vermögen mit <strong>der</strong> Stromgröße Einkommen zumindest ansatzweise vergleichbar zu machen,<br />
indem <strong>die</strong> Bestandsgröße Vermögen in Einkommenseinheiten bewertet wird. Zählt man anschließend beide<br />
Größen zusammen, resultiert eine fiktive Maßgröße <strong>der</strong> finanziellen Situation eines Haushalts o<strong>der</strong> einer<br />
Person aus einer ganzheitlichen finanziellen Perspektive.<br />
Bei <strong>der</strong> Bewertung des Vermögens in Einkommenseinheiten sind grundsätzlich verschiedene Ansätze denkbar.<br />
Beispielsweise könnte man als Maßgröße das aus dem Vermögen generierte Einkommen (Asset Income)<br />
verwenden. Ein Nachteil bei <strong>die</strong>sem Ansatz besteht jedoch darin, dass <strong>die</strong> Wahl <strong>der</strong> individuellen<br />
Vermögensstruktur einen erheblichen Einfluss auf den aus dem Vermögen erzeugten Einkommensstrom hat.<br />
Im Vorfeld des letzten Armuts- und Reichtumsberichts wurde deshalb ein Ansatz vorgeschlagen, <strong>der</strong> verkürzt<br />
dargestellt auf <strong>der</strong> Idee basiert, das gesamte dem Haushalt verfügbare Vermögen im Rahmen einer Simulation<br />
„zu veräußern“, um es anschließend unter Annahme eines geeigneten Zinssatzes in eine bis zum erwarteten<br />
Lebensende währende, fiktive „Sofortrente“ umzuwandeln. 182 Damit spiegelt <strong>die</strong>se Rente den Wert des<br />
Vermögens unter weiteren Zusatzannahmen, etwa zur individuellen Restlebenserwartung o<strong>der</strong> zum Zinssatz,<br />
wi<strong>der</strong>. Ergänzt man schließlich das Einkommen <strong>der</strong> Person um <strong>die</strong>se fiktive Rente, so erhält man <strong>die</strong> im<br />
Folgenden auch vereinfachend als das „Integrierte Einkommen“ bezeichnete Größe. Diese erlaubt<br />
grundsätzlich Aussagen zur finanziellen Situation einer Person unter Berücksichtigung ihrer Einkommens- und<br />
Vermögensituation.<br />
Bei <strong>der</strong> späteren Interpretation <strong>der</strong> Ergebnisse sind zahlreiche Modifikationen, <strong>die</strong> an den ursprünglichen<br />
Einkommens- und Vermögensgrößen durchgeführt werden, zu beachten. Zu den beiden modifizierten<br />
Ressourcenbegriffen gehören das „laufend verfügbare Einkommen“ sowie das „frei verfügbare Vermögen. 183<br />
Ziel <strong>die</strong>ser Modifikationen ist es, <strong>die</strong> Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Einkommens- und Vermögenssituation zwischen<br />
verschiedenen soziodemografischen Gruppen zu verbessern. Das frei verfügbare Einkommen, das auch bei<br />
unterschiedlichem sozialem Status weitestgehend vergleichbar sein soll, wird ermittelt, indem bei den<br />
Selbständigen <strong>die</strong> (fiktiven) Beiträge zur privaten Altersvorsorge abgezogen werden. Dar<strong>über</strong> hinaus wird für<br />
Arbeitnehmer ein (fiktiver) „Riester-Rentenbeitrag“ subtrahiert. Weiter werden den Selbständigen fiktive,<br />
akkumulierte Altersvorsorgebeiträge abgezogen, weil für (ehemals) abhängig Beschäftigte <strong>die</strong> Ansprüche aus<br />
<strong>der</strong> gesetzlichen Rentenversicherung nicht berücksichtigt werden können. Zudem wird das Vermögen im Fall<br />
<strong>der</strong> ehemals Selbständigen um den Rest des Altersvorsorgevermögens korrigiert. Zusammenfassend ist also<br />
festzustellen, dass <strong>die</strong> Anzahl an Annahmen und Modifikation im Fall <strong>der</strong> integrierten Analyse <strong>über</strong> <strong>die</strong><br />
Beamtenkorrektur, Bedarfsgewichtung, Imputation von Mieteinnahmen aus selbstgenutztem Wohneigentum<br />
etc., <strong>die</strong> ohnehin bereits bei <strong>der</strong> Verwendung des Begriffs des Nettoäquivalenzeinkommens implizit unterstellt<br />
werden, noch weiter zugenommen hat. 184<br />
182 Berücksichtigt werden dabei <strong>die</strong> aktuellsten altersspezifischen „Sterbetafeln“ <strong>der</strong> Deutschen Aktuarvereinigung e.V. aus<br />
dem Jahr 2004, <strong>die</strong> auf <strong>die</strong> jeweiligen Berichtsjahre fortgeschrieben werden.<br />
183<br />
Diese bislang realisierten Lösungsvorschläge, durch welche <strong>die</strong> traditionellen, eher „formal-juristischen“<br />
Ressourcenbegriffe adäquat gemacht werden können, wurden in Grabka et al. (2007) als zweites Integrationskonzept<br />
bezeichnet.<br />
184<br />
In Grabka et al. (2007) wurden drei verschiedene und mit Kardinalzahlen durchnummerierte so genannte<br />
„Integrationsansätze“ vorgestellt und diskutiert. Schließlich haben insbeson<strong>der</strong>e <strong>die</strong> Ergebnisse zum dritten<br />
Integrationsansatz Eingang in den 3. Armuts- und Reichtumsbericht gefunden. Um <strong>die</strong> adressatengerechte Kommunikation<br />
<strong>der</strong> empirischen Ergebnisse zu verbessern, <strong>die</strong> Transparenz <strong>der</strong> Vorgehensweise zu erhöhen und mögliche<br />
Mehrdeutigkeiten in <strong>der</strong> Begrifflichkeit zu verhin<strong>der</strong>n, wird <strong>die</strong>se Nomenklatur in <strong>die</strong>sem Gutachten zur Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> <strong>Berichterstattung</strong> konsoli<strong>die</strong>rt und vereinfacht. Aus Gründen <strong>der</strong> Konsistenz wird darauf hingewiesen, dass in Abschnitt<br />
8.2 im Wesentlichen das bisher so genannte „erste Integrationsverfahren“ aufgegriffen wird. In Abschnitt 8.3 wird auf das<br />
so genannte „dritte Integrationsverfahren“ verwendet. Damit sollen <strong>die</strong> Begriffe <strong>der</strong> „gemeinsamen <strong>Verteilung</strong> von<br />
Einkommen und Vermögen“ sowie <strong>der</strong> „eindimensionalen integrierten <strong>Verteilung</strong> von Einkommen und Vermögen“ deutlich<br />
erkennbar voneinan<strong>der</strong> getrennt werden, da jeweils unterschiedliche Eigenschaften des Zusammenhangs von Einkommen<br />
und Vermögen untersucht werden.


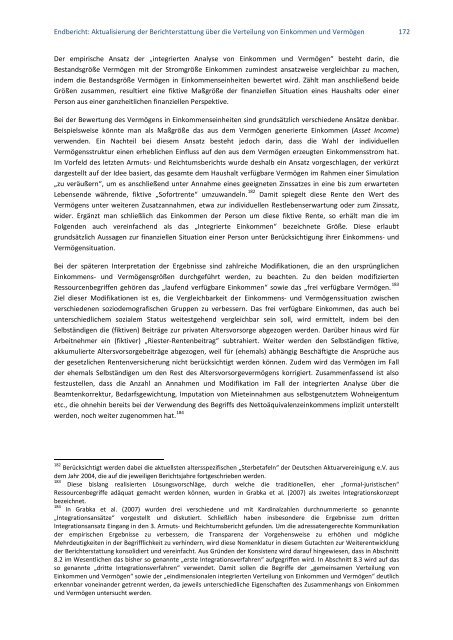

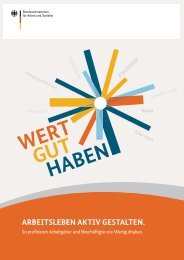
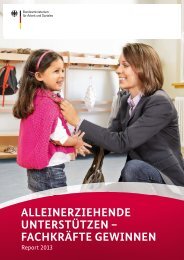



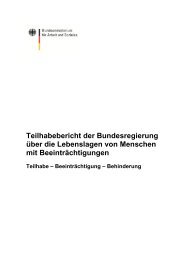
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)