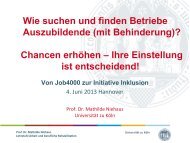Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Endbericht: <strong>Aktualisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Berichterstattung</strong> <strong>über</strong> <strong>die</strong> <strong>Verteilung</strong> von Einkommen und Vermögen 73<br />
Im Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland lassen sich nach wie vor deutliche Differenzen bezüglich <strong>der</strong><br />
Armutsrisikoquoten feststellen. Obwohl <strong>die</strong> Armutsrisikoquote in den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n, <strong>die</strong> von 2002 bis<br />
2005 stetig angestiegen war, im Berichtszeitraum wie<strong>der</strong> gesunken ist, während für Westdeutschland ein<br />
Anstieg <strong>der</strong> Armutsrisikoquote im Berichtszeitraum zu verzeichnen ist, bleibt <strong>der</strong> Unterschied zwischen Ostund<br />
Westdeutschland sehr deutlich.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Unterschiede <strong>der</strong> durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommen zwischen Männern und Frauen<br />
lassen sich auch Unterschiede bei den Armutsrisikoquoten zwischen den Geschlechtern erwarten. Dies wird so<br />
auch bestätigt. Die Armutsrisikoquote <strong>der</strong> Frauen war in jedem Jahr des Analysezeitraums deutlich höher als<br />
<strong>die</strong> <strong>der</strong> Männer. Die Entwicklung <strong>über</strong> den Berichtszeitraum erfolgt bei Frauen und Männern bis auf <strong>die</strong> Jahre<br />
2006/2007, in denen <strong>die</strong> Armutsrisikoquote <strong>der</strong> Männer leicht gestiegen und <strong>die</strong> <strong>der</strong> Frauen leicht gesunken<br />
ist, weitgehend gleichgerichtet. Von 2005 auf 2008 ist <strong>die</strong> Armutsrisikoquote <strong>der</strong> Frauen von 15,7% auf 16,2%,<br />
<strong>die</strong> <strong>der</strong> Männer lediglich von 13% auf 13,2% gestiegen. Der Anstieg <strong>der</strong> Armutsrisikoquote fällt damit bei den<br />
Frauen geringfügig höher aus als bei den Männern, <strong>der</strong>en Quote annähernd konstant blieb.<br />
Ein höheres Bildungsniveau senkt das Armutsrisiko, d.h. umgekehrt je niedriger <strong>der</strong> Bildungsabschluss, desto<br />
höher <strong>die</strong> Armutsrisikoquote. Im Berichtszeitraum haben sich <strong>die</strong> Armutsrisikoquoten insgesamt nur sehr leicht<br />
verän<strong>der</strong>t, allerdings in eine Richtung, durch <strong>die</strong> <strong>der</strong> genannte Zusammenhang verstärkt wird. Zwischen 2005<br />
und 2008 ist <strong>die</strong> Armutsrisikoquote für Hochschulabsolventen von 6,1% auf 5,4% leicht gesunken, während sie<br />
für Personen ohne beruflichen Abschluss im gleichen Zeitraum von 24,2% auf 27,3% gestiegen ist.<br />
Auch differenziert nach <strong>der</strong> sozialen Stellung lassen sich zum Teil erhebliche Unterschiede hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Armutsrisiken feststellen. Die höchste Armutsrisikoquote weisen nach <strong>die</strong>ser Kategorisierung in jedem Jahr des<br />
Analysezeitraums Arbeitslose auf. Die Armutsrisikoquote für <strong>die</strong>se Personengruppe ist außerdem zwischen<br />
2005 und 2008 um circa zehn Prozentpunkte von 44,5% auf 54,6% deutlich angestiegen – allerdings bezogen<br />
auf eine weitaus kleinere Zahl von Arbeitslosen. Da im Jahr 2005 <strong>die</strong> Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe<br />
und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II bereits realisiert war, kann <strong>die</strong> Zunahme <strong>die</strong>ser Quote dadurch nicht<br />
erklärt werden. An<strong>der</strong>s ist es mit <strong>der</strong> Verkürzung <strong>der</strong> Bezugsdaduer des Arbeitslosengeldes I, weil sich <strong>der</strong>en<br />
Wirkungen auf <strong>die</strong> finanzielle Situation <strong>der</strong> Haushalte erst schrittweise bemerkbar gemacht haben.<br />
Entscheidend dürfte jedoch wie<strong>der</strong>um <strong>die</strong> bereits am Ende von Abschnitt 5.2 beschriebene strukturelle<br />
Verän<strong>der</strong>ung innerhalb <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Arbeitslosen zugunsten kleinerer Haushalte (Alleinstehende und<br />
Alleinerziehende) sein, da <strong>die</strong>se aufgrund <strong>der</strong> Bedarfsgewichtung bei gleichem Pro-Kopf-Nettoeinkommen eher<br />
unter <strong>die</strong> Armutsrisikogrenze fallen. Zudem ist es im Aufschwung vor allem Arbeitslosen, <strong>die</strong> das höhere<br />
Arbeitslosengeld I bezogen, leichter gefallen, wie<strong>der</strong> eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden.<br />
Bei Rentnern und Pensionären ist <strong>die</strong> Armutsrisikoquote bis zum Jahr 2006 nahezu konstant geblieben (circa<br />
13%), danach bis 2008 gestiegen auf 16,7%. Allerdings bewegt sich <strong>die</strong> Armutsrisikoquote von Rentnern und<br />
Pensionären damit nach wie vor auf einem deutlich niedrigeren Niveau als <strong>die</strong>jenige von Arbeitslosen und nur<br />
geringfügig <strong>über</strong> <strong>der</strong>jenigen von Arbeitern. Erst seit dem Jahr 2006 beginnt sich <strong>die</strong> Schere zwischen <strong>die</strong>sen<br />
beiden Gruppen leicht zu öffnen. Zudem greift gerade bei Rentnern und Pensionären <strong>der</strong> Blick auf das<br />
Einkommen zu kurz, weil häufiger höhere Vermögenswerte vorhanden sind (vgl. Kapitel 7).<br />
Das geringste Armutsrisiko besteht bei Beamten, Angestellten und Selbständigen. Die Armutsrisikoquote <strong>der</strong><br />
Beamten ist während des Berichtszeitraums weitgehend unverän<strong>der</strong>t geblieben, wohingegen <strong>die</strong> <strong>der</strong><br />
Angestellten leicht gestiegen ist.


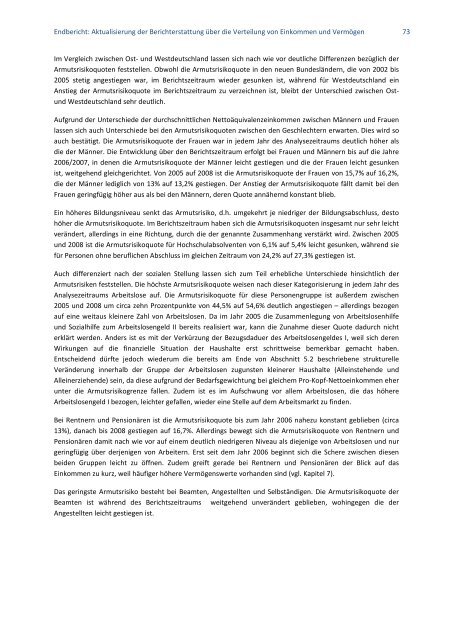

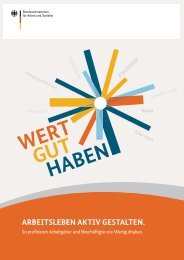
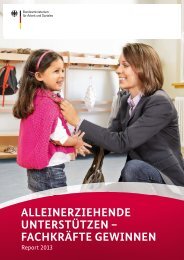



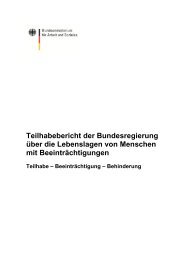
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)