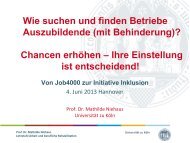Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Aktualisierung der Berichterstattung über die Verteilung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Endbericht: <strong>Aktualisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Berichterstattung</strong> <strong>über</strong> <strong>die</strong> <strong>Verteilung</strong> von Einkommen und Vermögen 326<br />
13 Die Dauerhaftigkeit von individuellem Einkommensreichtum und ihre<br />
Determinanten<br />
13.1 Motivation<br />
Ziel <strong>die</strong>ses Abschnitts ist es, erstmals ausführlich das Ausmaß und vor allem <strong>die</strong> Determinanten des<br />
persistenten Einkommensreichtums in Deutschland zu quantifizieren. Eine Betrachtung des persistenten<br />
Einkommensreichtums ist vor allem aus verteilungspolitischer Sicht bedeutsam. Einperiodige Reichtumsquoten<br />
wie <strong>die</strong> in Kapitel 9 ausgewiesenen geben zwar Auskunft <strong>über</strong> <strong>die</strong> Aufteilung <strong>der</strong> Bevölkerung in einen reichen<br />
und einen nicht-reichen Teil, sie beantworten jedoch nicht <strong>die</strong> Frage, ob es immer <strong>die</strong>selben Personen sind, <strong>die</strong><br />
in einem gegebenen Zeitraum zu den Reichen gehören o<strong>der</strong> inwiefern sich <strong>die</strong> Gruppe <strong>der</strong> Reichen von Jahr zu<br />
Jahr neu zusammensetzt. Das Wissen um <strong>die</strong> Fluktuation innerhalb <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Reichen kann aber zu einem<br />
vertieften Verständnis und einer differenzierteren Bewertung <strong>der</strong> Ungleichheit in einer Gesellschaft beitragen.<br />
Von unmittelbarem Interesse ist dabei auch, welche Bevölkerungsteile <strong>die</strong> größten Chancen auf persistenten<br />
Reichtum besitzen.<br />
Mit <strong>der</strong> Persistenz von Einkommenspositionen in Deutschland haben sich bereits einige Stu<strong>die</strong>n befasst. So<br />
betrachtet Groh-Samberg (2009) den Einkommensreichtum anhand <strong>der</strong> Daten des SOEP (1995-2008). Er findet<br />
einen Anteil von Personen mit einem Nettoäquivalenzeinkommen jenseits <strong>der</strong> 200%-Grenze an <strong>der</strong><br />
Gesamtbevölkerung von etwa 5 bis 7%. Der Anteil weist dabei eine klar steigende zeitliche Tendenz auf. Der<br />
Anteil <strong>der</strong>jenigen Personen, <strong>die</strong> in einem Zeitraum von 5 Jahren stets <strong>über</strong> <strong>der</strong> 200%-Grenze lagen, fällt mit 2<br />
bis 3% deutlich geringer aus. Auch hierbei deutet sich eine Zunahme des Anteils <strong>der</strong> dauerhaft<br />
Einkommensreichen in den letzten Jahren an.<br />
Eine ähnliche Analyse findet sich in Weick (2000), <strong>der</strong> mit Hilfe des SOEP für <strong>die</strong> Jahre 1992 bis 1998 eine N-<br />
Times-X-Messung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> oberhalb <strong>der</strong> 200%-Schwelle des Nettoäquivalenzeinkommens verbrachten<br />
Jahre durchführt. 11% <strong>der</strong> Personen in Westdeutschland gelingt es nach seiner Analyse, in jedem <strong>der</strong><br />
betrachteten sieben Jahre einkommensreich zu sein. Krause/Wagner (1997) führen auf Basis des SOEP, für <strong>die</strong><br />
Sechs-Jahres-Zeiträume von 1984 bis 1989 und 1990 bis 1995 ebenfalls N-Times-X-Messungen durch. Sie finden<br />
einen Anteil von 1% <strong>der</strong> Bevölkerung, <strong>der</strong> in allen sechs Jahren ein Einkommen oberhalb <strong>der</strong> 200%-Schwelle <strong>der</strong><br />
Nettoäquivalenzeinkommen bezog.<br />
Auch aus <strong>der</strong> reichhaltigen Literatur <strong>über</strong> <strong>die</strong> Mobilität hinsichtlich des Einkommens o<strong>der</strong> des Vermögens<br />
lassen sich Erkenntnisse zur Persistenz ableiten. 227 Aussagen <strong>über</strong> Dynamik o<strong>der</strong> Stabilität von<br />
Einkommenspositionen werden üblicherweise mit Transitionsmatrizen dargestellt. Dabei wird <strong>die</strong><br />
zweidimensionale Häufigkeitsverteilung von Einkommensklassen für zwei verschiedene Zeitpunkte betrachtet<br />
und angegeben, wie hoch <strong>die</strong> Anteile <strong>der</strong> Übergänge zwischen verschiedenen Klassen sind. Ihr großer Vorteil<br />
liegt in <strong>der</strong> hohen Anschaulichkeit und <strong>der</strong> einfachen und umfassenden Interpretation <strong>der</strong> Ergebnisse. Zudem<br />
erlauben sie auch eine Aussage <strong>über</strong> <strong>die</strong> Verweilquoten in den einzelnen Klassen. Der weitaus größte Teil<br />
bisheriger Stu<strong>die</strong>n, <strong>die</strong> <strong>die</strong>se Methodik verwenden, greift auf das SOEP zurück (z.B. <strong>die</strong> Armuts- und<br />
Reichtumsberichte <strong>der</strong> Bundesregierung sowie SVR 2009a, Frick/Grabka 2009, Schupp et al. 2005,<br />
Wagner/Krause 2001, Becker/Hauser 2004). Lediglich Merz/Zwick (2008) werten das Taxpayer-Panel aus. 228<br />
227<br />
Mobilitätsbetrachtungen spielen auch in den Armuts- und Reichtumsberichten <strong>der</strong> Bundesregierung eine Rolle,<br />
zumindest wenn es um <strong>die</strong> Betrachtung von Armut geht (vgl. Bundesregierung (2008, S.26) sowie Bundesregierung (2005,<br />
S.24f.) und Bundesregierung (2001, S. 29f.).<br />
228 Auch in <strong>der</strong> internationalen Forschung finden Transitionsmatrizen eine breite Anwendung, vgl. z.B. Acs/Zimmermann<br />
(2008), Bover (2008), Riihelä (2009), Saez/Veall (2007) und Jianakoplos/Menchik (1997). Eine weitere Möglichkeit <strong>der</strong><br />
Messung von Mobilität stellen spezielle Indizes dar, wie etwa <strong>der</strong> Shorrocks- o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bartolomew-Index. Sie erlauben<br />
jedoch keine Aussagen zur Stabilität von Einkommens- und/o<strong>der</strong> Vermögenspositionen und werden daher im vorliegenden<br />
Kapitel nicht weiter betrachtet. Ein Überblick <strong>über</strong> verschiedene Messkonzepte zur Mobilität findet sich etwa in Fabig<br />
(1999).


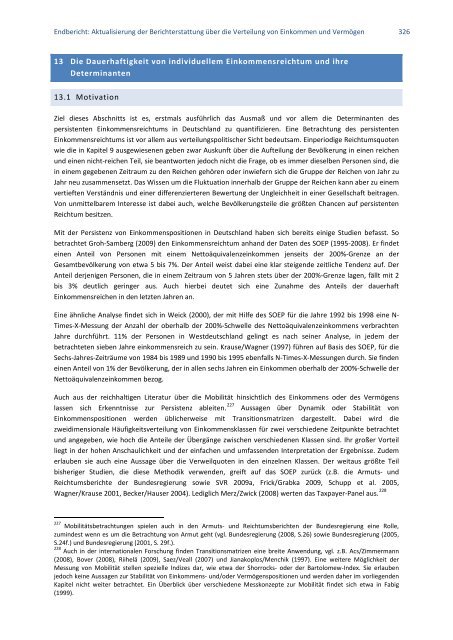

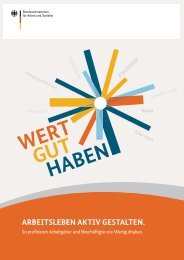
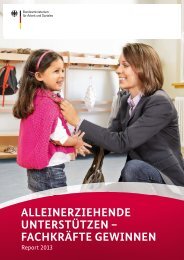



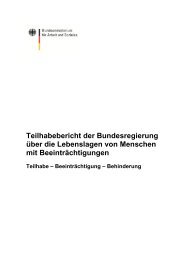
![Begründung zum Referentenentwurf [PDF, 98KB]](https://img.yumpu.com/23386636/1/184x260/begrundung-zum-referentenentwurf-pdf-98kb.jpg?quality=85)