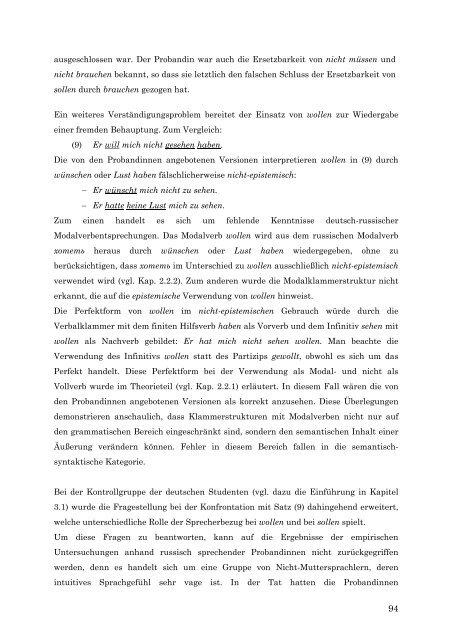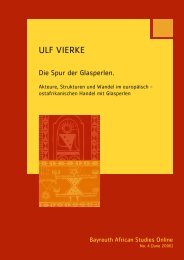Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ausgeschlossen war. Der Probandin war auch die Ersetzbarkeit von nicht müssen und<br />
nicht brauchen bekannt, so dass sie letztlich den falschen Schluss der Ersetzbarkeit von<br />
sollen durch brauchen gezogen hat.<br />
Ein weiteres Verständigungsproblem bereitet der Einsatz von wollen zur Wiedergabe<br />
einer fremden Behauptung. Zum Vergleich:<br />
(9) Er will mich nicht gesehen haben.<br />
Die von den Probandinnen angebotenen Versionen interpretieren wollen in (9) durch<br />
wünschen oder Lust haben fälschlicherweise nicht-epistemisch:<br />
− Er wünscht mich nicht zu sehen.<br />
− Er hatte keine Lust mich zu sehen.<br />
Zum einen handelt es sich um fehlende Kenntnisse deutsch-russischer<br />
<strong>Modalverben</strong>tsprechungen. Das Modalverb wollen wird aus dem russischen Modalverb<br />
хотеть heraus durch wünschen oder Lust haben wiedergegeben, ohne zu<br />
berücksichtigen, dass хотеть im Unterschied zu wollen ausschließlich nicht-epistemisch<br />
verwendet wird (vgl. Kap. 2.2.2). Zum anderen wurde die Modalklammerstruktur nicht<br />
erkannt, die auf die epistemische Verwendung von wollen hinweist.<br />
Die Perfektform von wollen im nicht-epistemischen Gebrauch würde durch die<br />
Verbalklammer <strong>mit</strong> dem finiten Hilfsverb haben als Vorverb und dem Infinitiv sehen <strong>mit</strong><br />
wollen als Nachverb gebildet: Er hat mich nicht sehen wollen. Man beachte die<br />
Verwendung des Infinitivs wollen statt des Partizips gewollt, obwohl es sich um das<br />
Perfekt handelt. Diese Perfektform bei der Verwendung als Modal- und nicht als<br />
Vollverb wurde im Theorieteil (vgl. Kap. 2.2.1) erläutert. In diesem Fall wären die von<br />
den Probandinnen angebotenen Versionen als korrekt anzusehen. Diese Überlegungen<br />
demonstrieren anschaulich, dass Klammerstrukturen <strong>mit</strong> <strong>Modalverben</strong> nicht nur auf<br />
den grammatischen Bereich eingeschränkt sind, sondern den semantischen Inhalt einer<br />
Äußerung verändern können. Fehler in diesem Bereich fallen in die semantisch-<br />
syntaktische Kategorie.<br />
Bei der Kontrollgruppe der <strong>deutschen</strong> Studenten (vgl. dazu die Einführung in Kapitel<br />
3.1) wurde die Fragestellung bei der Konfrontation <strong>mit</strong> Satz (9) dahingehend erweitert,<br />
welche unterschiedliche Rolle der Sprecherbezug bei wollen und bei sollen spielt.<br />
Um diese Fragen zu beantworten, kann auf die Ergebnisse der empirischen<br />
Untersuchungen anhand russisch sprechender Probandinnen nicht zurückgegriffen<br />
werden, denn es handelt sich um eine Gruppe von Nicht-Muttersprachlern, deren<br />
intuitives Sprachgefühl sehr vage ist. In der Tat hatten die Probandinnen<br />
94