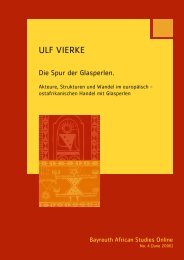Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aufgabe wurde oft danach gefragt). Des Weiteren ist in den nächsten beiden Versionen<br />
wieder die parallele Verwendung des zu ersetzenden Wortes <strong>mit</strong> den <strong>Modalverben</strong> zu<br />
beobachten:<br />
− Es ist ausgeschlossen, dass er der Täter soll sein.<br />
− Es ist ausgeschlossen, dass er könnte das machen.<br />
Abgesehen davon, dass die beiden Konstruktionen temporal und syntaktisch falsch<br />
gebildet sind, wird auch semantisch weder durch soll noch durch könnte eine sinntreue<br />
Wiedergabe erreicht.<br />
Was genau bringt Beispiel (3) zum Ausdruck? In der Aussage Es ist ausgeschlossen [...]<br />
wird die absolute Überzeugung geäußert, dass es nicht zutrifft, dass er der Täter war.<br />
Dieser Sachverhalt lässt sich durch die epistemische Verwendung von können<br />
paraphrasieren Er kann nicht der Täter gewesen sein. Diese Version wird sowohl von<br />
Buscha/Linthout (2000) als auch von den meisten Studenten der Kontrollgruppe<br />
angeboten. Einige verwenden aber die <strong>Modalverben</strong> können sowie dürfen und müssen<br />
im Konjunktiv parallel zu ausgeschlossen, ähnlich wie einige der Probandinnen: Es<br />
kann ausgeschlossen werden / Es dürfte ausgeschlossen sein / Es müsste ausgeschlossen<br />
sein, dass er der Täter war. Alle drei Varianten weisen auf einen unterschiedlichen<br />
Grad der Überzeugtheit hin, der aber in allen Fällen niedriger ausfällt als bei der<br />
Konstruktion es ist ausgeschlossen. Eine sinntreue Umformulierung wurde hier also<br />
verfehlt, was bemerkenswert ist, da es sich wie erwähnt um deutsche Muttersprachler<br />
handelte. Umso begreiflicher erscheinen die Schwierigkeiten, auf die Nicht-<br />
Muttersprachler beim Erlernen der <strong>deutschen</strong> Sprache stoßen.<br />
Bei der Interpretation des nächsten Satzes treten Fehler sowohl in der Semantik als<br />
auch in der Grammatik auf. Zum Vergleich:<br />
(4) An wen denkt er jetzt wohl?<br />
Wie schon bei einigen Umformungen von Satz (3) der Aufgabe I beobachtet wird der<br />
Fragesatz hier durch einen Aussagesatz wiedergegeben:<br />
− Es kann sein, dass er jetzt an jemanden denkt.<br />
Semantisch kann die Interpretation durch das Modalverb können als korrekt betrachtet<br />
werden (vgl. etwa die nächste Version):<br />
− An wen könnt er jetzt denken?<br />
Morphologisch ist hier jedoch die Konjugation von können in der 3. Pers. Sg. für den<br />
Konjunktiv fehlerhaft, für die die -e-Endung zutreffend ist. Vertretbar wäre auch eine<br />
Lösung <strong>mit</strong>tels des Indikativs kann, der allerdings noch weiter von der angebotenen<br />
Form entfernt ist.<br />
98