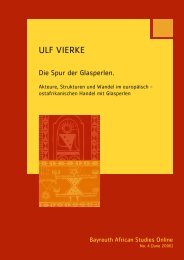Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die nächste Version ist durch das Auslassen des Akkusativsobjekts und die unzulässige<br />
Verwendung des Modalverbs müssen gekennzeichnet:<br />
− Muss er jetzt wohl denken?<br />
Da<strong>mit</strong> wird die semantische Größe verändert und die Aussage unvollständig<br />
wiedergegeben.<br />
Auffällig ist folgende Version durch den Ersatz der 3. Pers. durch die 2.:<br />
− Willst du jetzt an jemanden denken?<br />
Außerdem ist das Interrogativpronomen wen durch das Indefinitpronomen jemanden<br />
ersetzt. Dabei bezieht sich die Frage nicht mehr nur auf ein Satzglied wie in (4), sondern<br />
auf den gesamten im Satz ausgedrückten Sachverhalt. Semantisch betrachtet kann das<br />
Modalverb wollen nicht als ein Äquivalent für Beispiel (4) herangezogen werden, weil es<br />
sich viel mehr um eine Annahme als um eine Absicht bzw. einen Wunsch handelt.<br />
Buscha/Linthout (2000) halten folgende drei Varianten für die Wahl des Modalverbs für<br />
richtig: An wen mag / kann / könnte er jetzt denken? Von der Kontrollgruppe wurden<br />
zusätzliche Interpretationen vorgeschlagen: An wen dürfte er jetzt wohl denken? Ich<br />
möchte wissen, an wen er jetzt denkt? An wen wird er wohl denken? An wen wird er jetzt<br />
wohl denken müssen? Während die erste Version vielleicht nicht die gängigste, aber eine<br />
durchaus geeignete Möglichkeit darstellt, ist die Analyse der zweiten Version nicht ganz<br />
so einfach. Das Modalverb möchten bzw. mögen ist zwar in der Lage, eine korrekte<br />
Umformulierung zu liefern (vgl. die erste Lösungsvariante von Buscha/Linthout 2000:<br />
217 f.) wird jedoch syntaktisch auf kreative Weise eingesetzt, nämlich innerhalb eines<br />
einleitenden Satzteiles <strong>mit</strong> neuem Subjekt ich, wodurch die direkte Frage in eine<br />
indirekte verwandelt wird. Nach Meinung der Verfasserin ist Satz (4) <strong>mit</strong> dieser Lösung<br />
sinngemäß wiedergegeben. In den letzten beiden Versionen der Kontrollgruppe ist zwar<br />
der Sinn des Ausgangssatzes getroffen, allerdings nicht unter Verwendung eines<br />
Modalverbs, sondern von werden. Dass die letzte Version zusätzlich müssen beinhaltet,<br />
ändert nichts an dieser Analyse.<br />
Interessanterweise verzichten Buscha/Linthout (2000) bei ihren Lösungsvorschlägen auf<br />
die Modalpartikel wohl. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zeigen jedoch,<br />
wie harmonisch sich wohl auch in Sätze <strong>mit</strong> dürfen, müssen, können, mögen oder werden<br />
einfügt. Auf diese Weise gehen die Lebendigkeit und Natürlichkeit in Beispiel (4) durch<br />
die Umformung nicht verloren. Nach der Interpretation von Buscha/Linthout (2000)<br />
können die Deutschlernenden zu irreführenden Ergebnissen kommen und die<br />
Modalpartikeln als Paraphrasen der <strong>Modalverben</strong> oder als Redundanzelemente und<br />
nicht als Verstärkungs- oder Verknüpfungs<strong>mit</strong>tel betrachten. Die Mängel in den<br />
99