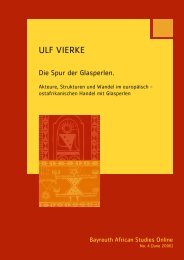Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(11) По щучьему велению, по моему хотению [...]. (Po ščuč'emu veleniju, po<br />
moemu choteniju [...].)<br />
− Auf den ersten Wunsch hin [...].<br />
Näher wird hier auf die kontrastive Analyse des Wortbildungssystems nicht<br />
eingegangen, da diese Thematik außerhalb des Rahmens der in dieser<br />
Dissertationsschrift gesetzten Ziele steht.<br />
Die morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der <strong>Modalverben</strong> werden<br />
traditionellerweise <strong>mit</strong> den Vollverben kontrastiert, um ihre Besonderheit zu<br />
akzentuieren (vgl. Bury 2000: 56 ff, Engel 2002: 90 ff, Heilmann 2002: 39 ff). Es hängt<br />
im Wesentlichen von der Zielgruppe des Autors ab, wie weit er dabei geht. Die<br />
Beachtung einiger Aspekte, wie die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen in<br />
Kapitel 3 gezeigt haben, ist jedoch unverzichtbar. Es handelt sich um die<br />
Inkorporationsverfahren der Grammatikklammer:<br />
(12) Sie hat diesen Film sehen wollen.<br />
(13) Sie will diesen Film gesehen haben.<br />
Die Beschäftigung <strong>mit</strong> dieser Thematik demonstriert nicht nur eine syntaktische<br />
Spezifizierung, sondern auch eine semantische Nuance bei der Verwendung der<br />
<strong>Modalverben</strong>: Das Modalverb wollen behält im Beispiel (12) seine nicht-epistemische<br />
Bedeutung von Absicht bzw. Wunsch. Bei einer Inkorporation der Perfektklammer in die<br />
Modalklammer in Beispiel (13) hingegen wird das Modalverb wollen auf die epistemische<br />
Bedeutung einer Behauptung eingeschränkt.<br />
Übergangen wird bei einigen Autoren in diesem Zusammenhang der morphologische<br />
Aspekt. Dieser kritikwürdige Punkt wurde im theoretischen Teil der Arbeit bezogen auf<br />
Eisenberg et al. (1998), Engel (2002) und Weinrich (2005) angesprochen (vgl. Kap. 2.1.3).<br />
Der Unterschied zwischen den Beispielen (12-13) liegt sowohl in der Bedeutung und im<br />
Satzbau als auch im Tempus. Die Behauptung in (13) wird in der Gegenwart aufgestellt<br />
und bezieht sich auf einen in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt. Im Russischen<br />
kann dieser Unterschied ausschließlich <strong>mit</strong>tels der Lexik wiedergegeben werden,<br />
beispielsweise für (13) durch ein Verb der Behauptung und nicht durch ein Verb des<br />
Wunsches wie in Beispiel (12) (vgl. dazu auch Kap. 2.2.2).<br />
Die Konjunktivformen benötigen bei der Ver<strong>mit</strong>tlung der <strong>deutschen</strong> <strong>Modalverben</strong> eine<br />
auf die russische Zielgruppe fokussierte Darstellung. Im Laufe der empirischen<br />
Untersuchungen wurde festgestellt, dass die russisch sprechenden Deutschlernenden<br />
große <strong>Probleme</strong> beim Konjunktivgebrauch hatten (vgl. Kap. 3.2.2.2). Die Schwierigkeiten<br />
137