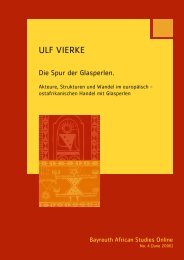Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wie es im Kapitel 2.2.2 erwähnt worden ist, gibt es im Russischen keine entsprechende<br />
Modalverbgruppe beim epistemischen Gebrauch. Das russische Modalverb мочь kann<br />
zwar für die Wiedergabe von können, müssen, dürfen und mögen epistemisch verwendet<br />
werden, ist jedoch nicht in der Lage, alle die in Tabelle 4 dargestellten<br />
Bedeutungsvarianten wiederzugeben. Dafür sind im Russischen andere lexikalische<br />
Entsprechungen sowie syntaktische Konstruktionen zuständig, etwa возможно /<br />
möglicherweise, наверно / vielleicht, должно быть / wahrscheinlich, скорее всего /<br />
höchstwahrscheinlich. Aber auch sie können einander sinngemäß ersetzen. Eine genaue<br />
Zuordnung kann nur im konkreten Kontext erfolgen und ist in hohem Maße von der<br />
Einstellung und Meinung des Sprechers abhängig. Einige Beispiele für modale<br />
Äquivalente zu können, müssen, dürfen und mögen wurden im einleitenden Teil zu<br />
Kapitel 2.2.2 angeführt; einen Überblick gibt Tabelle 5 am Ende dieses Kapitels.<br />
Wollen und sollen können zur Redewiedergabe dienen und dabei die Meinung des<br />
Sprechers zum Wahrheitsgehalt des ausgesagten Sachverhalts zum Ausdruck bringen.<br />
Diese Fähigkeit grenzt wollen und sollen von den anderen klassischen <strong>Modalverben</strong> in<br />
der epistemischen Lesart eindeutig ab. Verständlicherweise ergeben sich daraus<br />
mindestens zwei Fragen: Handelt es sich dabei um grundsätzlich unterschiedliche<br />
Lesarten? Und wenn dies der Fall sein sollte, wie kann der Sprecherbezug bei einer<br />
durch wollen bzw. sollen ver<strong>mit</strong>telten Rede variieren? Um diese Fragen zu beantworten,<br />
sollte man sich auf konkrete Beispiele beziehen. Zum Vergleich:<br />
(9) Anna will ihn nicht gesehen haben.<br />
(10) Anna soll ihn nicht gesehen haben.<br />
In Satz (9) geht die Behauptung von der Person selbst aus, Anna sagt, sie habe ihn nicht<br />
gesehen. (10) erfordert eine andere Interpretation, und zwar, dass eine andere Person<br />
bzw. andere Personen behaupten, Anna habe ihn nicht gesehen. Das heißt, dass sich der<br />
Sprecher durch wollen auf die Äußerung der Person im Subjekt und durch sollen auf die<br />
Äußerung eines Dritten bezieht.<br />
Welche Rolle spielt der Sprecherbezug beim referierenden wollen bzw. sollen? In der<br />
Literatur herrscht hier Uneinigkeit. Einige Autoren sprechen über eine Distanzierung<br />
seitens des Sprechers (vgl. Plank 1981: 57 ff, Weinrich 1993: 312 ff, Gladrow 1998: 110),<br />
andere stimmen dem nicht zu (vgl. Wunderlich 1981: 28, Ölschläger 1989: 235, Letnes<br />
2002: 102).<br />
An den Beispielen (9-10) ist ersichtlich, dass die beiden <strong>Modalverben</strong> wollen und sollen<br />
eine <strong>mit</strong>telbare Information übertragen. Der Sprecher distanziert sich dabei von dieser<br />
Information und stellt gleichzeitig die Wahrheit bzw. Falschheit dieser Information in<br />
53