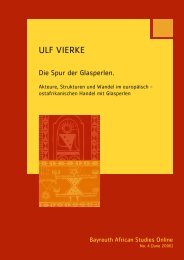Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Buscha/Linthout (2000) präsentieren in Abbildung 16 die <strong>Modalverben</strong> unter drei<br />
Gesichtspunkten die Einstellung des Sprechers betreffend. Zum einen handelt es sich<br />
um eine Vermutung oder Schlussfolgerung, die durch mögen, können, werden sowie<br />
müssen im Indikativ, aber auch durch dürfen und können im Konjunktiv II realisiert<br />
werden. Zum anderen werden sollen und wollen als Ausdrucks<strong>mit</strong>tel zur Wiedergabe<br />
einer Information, eines Gerüchts oder einer Behauptung verwendet. Schließlich stellen<br />
die Autorinnen sollen im Konjunktiv II separat von den anderen<br />
Bedeutungsmöglichkeiten der <strong>Modalverben</strong> als Ausdruck einer Empfehlung dar.<br />
Buscha/Linthout (2000) versuchen, semantische Überschneidungen von Äußerungen<br />
<strong>mit</strong> <strong>Modalverben</strong> durch Umschreibungen, beispielsweise durch Adverbien zu klären (vgl.<br />
Abb. 16). Die Aufzählung semantischer eng beieinander liegender Synonyme (etwa bei<br />
der Vermutungsbedeutung) ist für Nicht-Muttersprachler zumindest auf den ersten<br />
Blick verwirrend. Es findet sich nirgends, auch nicht außerhalb der Tabelle, der explizite<br />
Hinweis, dass es sich um unterschiedliche Stärkegrade z.B. der Vermutung handelt.<br />
Orientiert man sich an den angegebenen Bedeutungen in der <strong>mit</strong>tleren Spalte, kann es<br />
ebenfalls zu Missverständnissen kommen. Beispielsweise kann die Wiedergabe einer<br />
Behauptung (hier bei wollen angeführt) auch durch sollen in epistemischer Verwendung<br />
erfolgen. Der springende Punkt, nämlich dass bei wollen das Subjekt eine Behauptung<br />
sich selbst betreffend äußert (vgl. dazu Kap. 2.2.2.2), versteckt sich in den Synonymen in<br />
der letzten Spalte. Noch mehr als bei der Vermutungsbedeutung wird bei der<br />
Wiedergabe einer fremden Äußerung eine Angabe zum Grad der Distanzierung seitens<br />
des Sprechers vermisst. Die drei Beispiele äußern – wie im Empirieteil an anderen<br />
Kontexten (vgl. Kap. 3.2.2.2) erarbeitet wurde – unterschiedliches Vertrauen des<br />
Sprechers in die Information und werden dennoch gemeinsam unter den Begriff <strong>mit</strong><br />
einer gewissen Distanz kategorisiert. Hier wird nach Meinung der Verfasserin deutlich,<br />
dass eine verständliche Ver<strong>mit</strong>tlung der Semantik der <strong>Modalverben</strong> in ihrer ganzen<br />
Komplexität nur <strong>mit</strong> aussagekräftigen, situationsbezogenen Kontexten möglich ist.<br />
Nach dieser Grammatikerklärung (siehe Abb. 16) wird angeboten, Satzbildungs- sowie<br />
Ergänzungsübungen anzufertigen. Diese Übungen sollen die Grammatikkompetenzen<br />
der ausländischen Deutschlernenden festigen. Als Beispiel findet sich in Abbildung 17<br />
eine Übung zur Vermutungsbedeutung.<br />
128