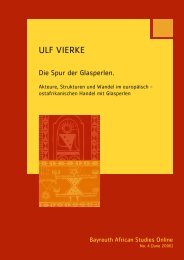Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nicht übergangen werden sollte. Außerdem bleibt offen, ob sich das Modal-Passiv durch<br />
dürfen auch im affirmativen Kontext sinngemäß übertragen lässt.<br />
Dem Modal-Passiv steht das Modal-Aktiv in der haben + zu-Konstruktion gegenüber,<br />
das sich durch müssen paraphrasieren lässt (vgl. Weinrich 2005: 287). Eisenberg et al.<br />
(1998: 105) setzen sich <strong>mit</strong> der Thematik genauer auseinander und weisen darauf hin,<br />
dass der modale Infinitiv <strong>mit</strong> haben einerseits durch nicht müssen sowie nicht brauchen<br />
in der Bedeutung von Notwendigkeit sowie andererseits durch dürfen, bezogen auf die<br />
Verneinung des angesprochenen Sachverhalts, ersetzt werden kann. Anschließend<br />
deuten die Autoren die Konkurrenz der haben- und sein-Konstruktion an.<br />
Der Begriff Modalität wird auch aus Tempus-Perspektive beleuchtet. Ein besonderer<br />
Wert wird auf das modale Futur gerichtet, das neben der Tempus-Perspektive auch eine<br />
Vermutung bzw. eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft, Gegenwart oder<br />
Vergangenheit aufweisen kann. Oft werden Modalpartikeln oder Adverbien für diese<br />
unsichere Geltung als Abstützungselemente gebraucht. Die durch die Futurformen<br />
ausgedrückte Gewissheitsmodalität beschreibt Weinrich (2005) im Gegensatz zu<br />
anderen Standardgrammatiken ausschließlich im Rahmen der Tempus-Perspektive.<br />
Beispielsweise erwähnen Eisenberg et al. (1998: 102 f) werden als Konkurrenz zu wollen<br />
bezogen auf Zukünftiges, <strong>mit</strong> der Anmerkung, dass der Einsatz von wollen das<br />
Willensmoment stärker als die werden-Fügung betont. Engel (2002: 91 ff) betrachtet<br />
werden aus sprecherbezogener und subjektbezogener Perspektive im semantischen<br />
Umfeld der <strong>Modalverben</strong>, ohne auf seine Bedeutungsnuancierung hinzuweisen. Die<br />
angeführten Beispielsätze sind für Nicht-Muttersprachler weniger hilfreich, wenn nicht<br />
sogar irreführend, weil sie als Synonyme verstanden werden können. Zum Vergleich<br />
(zitiert nach Engel 2002: 92; Hervorhebungen durch die Verfasserin):<br />
„Müssen drückt eine starke, durch Fakten gestützte Vermutung aus:<br />
(18) Erich muss es gewusst haben.<br />
Das bedeutet: Es ist nahezu offenkundig, dass Erich es gewusst hat.<br />
Werden drückt eine zuversichtliche Vermutung aus:<br />
(19) Hanna wird es gewusst haben.<br />
Das bedeutet: Der Sprecher vermutet, dass Hanna es gewusst hat“.<br />
Nach Einschätzung der Verfasserin sind die von Engel (2002) dargestellten<br />
Interpretationen von müssen und werden für ausländische Deutschlernende kaum<br />
voneinander zu unterscheiden. Die unterschiedliche Nuancierung einer starken und<br />
31