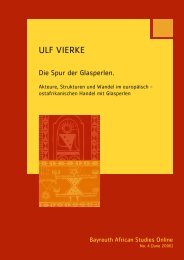Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Empörung über die lange Wartezeit Ausdruck verleiht. Dieser subjektive Aspekt wird<br />
vor allem durch das Adverb endlich erreicht. Die Autorinnen bieten folgende<br />
Paraphrasierung für Satz (10):<br />
(11) Nach langer Wartezeit wurde es ihnen gestattet, das Land zu verlassen.<br />
Diese Umformulierung ohne Verwendung von endlich weist deutlich darauf hin, dass<br />
der Sprecherbezug von den Autorinnen nicht wahrgenommen und der Satz rein nicht-<br />
epistemisch verstanden wurde.<br />
Wie schon in Kapitel 3.2.2 erwähnt mussten deutsche Studierende als Kontrollgruppe<br />
befragt werden, um die Korrektheit der Ergebnisse einer der schriftlichen Aufgaben<br />
verifizieren zu können. Dies weist auf die Notwendigkeit hin, zusätzliche Materialien<br />
anzuwenden, was offensichtlich gegen dieses Lehrwerk spricht. Zum Vergleich:<br />
(12) An wen denkt er jetzt wohl?<br />
Die von Buscha/Linthout (2000: 217) angebotenen Lösungen sind:<br />
(13) An wen mag er jetzt denken?<br />
(14) An wen kann er jetzt denken?<br />
(15) An wen könnte er jetzt denken?<br />
Von der Kontrollgruppe wurden zusätzliche Varianten vorgeschlagen:<br />
(16) An wen dürfte er jetzt wohl denken?<br />
(17) An wen wird er jetzt wohl denken müssen?<br />
(18) An wen wird es wohl denken?<br />
(19) Ich möchte wissen, an wen er jetzt denkt?<br />
Diese Alternativen wurden bereits im empirischen Teil ausführlich bewertet (vgl. Kap.<br />
3.2.2). Im Gegensatz zur <strong>deutschen</strong> Kontrollgruppe verzichten die Autorinnen außerdem<br />
bei ihren Lösungsvorschlägen auf die Modalpartikel wohl. Auch diesbezüglich wurde in<br />
den empirischen Untersuchungen gezeigt, wie harmonisch sich wohl in Verbindung <strong>mit</strong><br />
dürfen, müssen, können, mögen oder werden verhält: Die Lebendigkeit und Flüssigkeit in<br />
Beispiel (12) gehen dadurch bei der Umformung nicht verloren. Dass die Modalpartikel<br />
in den Lösungsvorschlägen von Buscha/Linthout (2000) weggelassen wird, ist auch<br />
didaktisch unglücklich. Die Deutschlernenden können dadurch zu falschen Schlüssen<br />
kommen und die Modalpartikeln als Paraphrasen der <strong>Modalverben</strong> oder als<br />
Redundanzelemente und nicht als Verstärkungs- oder Verknüpfungs<strong>mit</strong>tel betrachten.<br />
Mängel der gleichen Art wurden im theoretischen Teil in Kapitel 2.1.3 auch bei den<br />
Standardgrammatiken beobachtet.<br />
Insgesamt kann zu Buscha/Linthout (2000) festgehalten werden, dass die didaktische<br />
Konzeption auf den ersten Blick sinnvoll und zweckmäßig erscheint, bei genauerer<br />
130