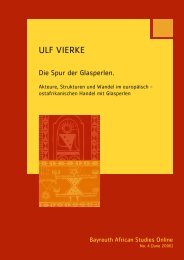Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beschaffenheit sein können, und zwar explizit wie implizit. Die Autorin schenkt der<br />
objektiven Lesart der <strong>deutschen</strong> <strong>Modalverben</strong> im Vergleich zur subjektiven mehr<br />
Aufmerksamkeit. Demzufolge bleiben einige Fragestellungen in Bezug auf die<br />
Besonderheiten der epistemischen Verwendungsweise der <strong>Modalverben</strong> offen.<br />
Eine neue Dimension der <strong>Modalverben</strong>problematik eröffnet Ammary (1996). Der Autor<br />
prägt die bis dato fehlende Definition der Modalität im Arabischen und gibt arabische<br />
Modalentsprechungen für wollen, sollen, mögen, können, müssen, dürfen sowie werden<br />
und brauchen durch die Verbgruppen des Vermutens (des Herzens), des Beinahseins<br />
(der Hoffnung) sowie die Verben der Gewissheit und der Wahrscheinlichkeit.<br />
Die <strong>deutschen</strong> <strong>Modalverben</strong> finden auch im Chinesischen Äquivalente (Xiao 1996). Der<br />
Schwerpunkt dieser Modalverbforschung liegt in der Semantik. Anhand empirischer<br />
Untersuchungen <strong>mit</strong> chinesischen Studenten wurde dargestellt, dass – da die<br />
chinesischen <strong>Modalverben</strong> in der Regel keine modalisierende Funktion aufweisen – die<br />
subjektive Einschätzung eines Sachverhalts in der chinesischen Sprache meist durch<br />
Verwendung von Modalwörtern ausgedrückt wird. Dies erschwert die erfolgreiche<br />
Beherrschung der subjektiven Verwendung der <strong>deutschen</strong> <strong>Modalverben</strong>. Für dieses<br />
Problem sucht die Autorin einen didaktisch-methodologischen Lösungsweg.<br />
Milan (2001) beschränkt sein Untersuchungsgebiet auf das Modalverbpaar müssen und<br />
sollen im Deutschen und das Modalverb dovere im Italienischen. Ausgehend von einer<br />
Modalitätsdefinition als propositionaler (Sprecher-)Einstellung und entsprechend den<br />
drei propositionalen Einstellungen des Sagens, Glaubens und Wollens werden die drei<br />
Modalitätsbereiche der Behauptung, Evaluation und Volition er<strong>mit</strong>telt. Je nach Art der<br />
behauptenden, evaluierenden oder wollenden Instanz lassen sich in jedem der drei<br />
Modalitätsbereiche mehrere Modalitätstypen unterscheiden. Die müssen-, sollen- und<br />
dovere-Sätze werden nach diesen Kriterien analysiert und im Hinblick auf ihre<br />
spezifische funktionale Leistung untersucht.<br />
Schon anhand dieser wenigen Beispiele in der jüngeren Vergangenheit lässt sich<br />
erkennen, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zur kontrastiven Behandlung<br />
der Modalverb-Thematik zur Anwendung kam. Zumindest was die deutsch-russischen<br />
Untersuchungen angeht sind die beobachteten Ansätze zum Teil lückenhaft, so dass<br />
dieser Bereich eine genaue kontrastive Analyse verdient.<br />
Die vorliegende Arbeit will sich auf die klassischen <strong>Modalverben</strong> dürfen, können,<br />
müssen, mögen, sollen und wollen sowie auf ihre paraphrasierten Konkurrenzformen im<br />
Deutschen und ihre Entsprechungen im Russischen konzentrieren.<br />
37