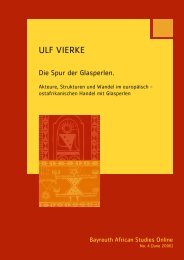Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Probleme mit deutschen Modalverben - OPUS Bayreuth - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Im Großen Wörterbuch der <strong>deutschen</strong> Sprache wird unter Modalität ein „in<br />
unterschiedlicher sprachlicher Form ausdrückbares Verhältnis des Sprechers zur<br />
Aussage bzw. der Aussage zur Realität oder Realisierung“ verstanden (vgl. Drosdowski<br />
1978: 1804).<br />
Beim Vergleich der einschlägigen Grammatiken und Monographien zu den Teilgebieten<br />
des Konjunktivs und zum Modalen überhaupt stellt Jongeboer (1985) fest, dass auf<br />
keinem Gebiet der Grammatik soviel Uneinigkeit wie bei dem Begriff der Modalität<br />
herrscht: „Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Irrgarten, in dem jeder Grammatiker<br />
sich einen Weg sucht und leider oft nicht sieht, dass er in einer Sackgasse gelandet ist“<br />
(vgl. Jongeboer 1985: 14).<br />
Es erscheint sehr schwierig, die verschiedenen Modalitätsdefinitionen zu einem Begriff<br />
zusammenzufassen. Neben den etablierten Positionen wie etwa von Admoni (1982),<br />
Heyse (1973), Krušel'nickaja (1961), Lyons (1980), Weidner (1986), Vinogradov (1960)<br />
existieren auch jüngere Begriffe der Sprachwissenschaft der Gegenwart, wie etwa von<br />
Bayer (2000) oder Gladrow (1998), die sich wohl nur als eine Variation der alten<br />
Begrifflichkeit interpretieren lassen.<br />
Dennoch kann man aus der Sicht der Verfasserin bei den verschiedenen<br />
sprachwissenschaftlichen Definitionen von Modalität einen gemeinsamen Kern<br />
erkennen: Modalität bezeichnet das Verhältnis des Sprechers zur Aussage und der<br />
Aussage zur Realität.<br />
Diesen Gedanken illustriert eine der traditionellen Differenzierungsmöglichkeiten der<br />
globalen Kategorie der Modalität, nämlich die Einführung der nicht-epistemischen und<br />
epistemischen Subkategorisierung (vgl. Abb. 2). Unter dem Begriff nicht-epistemisch<br />
wird das Verhältnis des Gesagten zur Wirklichkeit verstanden. Dieser Kategorie steht<br />
die epistemische gegenüber, die die Einschätzung des Sprechers bzw. Schreibers zum<br />
Gesagten aus dem Gesichtspunkt der Realität zum Ausdruck bringt (vgl. dazu Beljaeva<br />
1990, Jachnow 1994).<br />
13