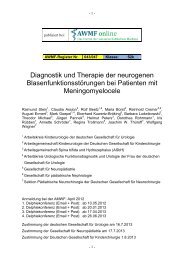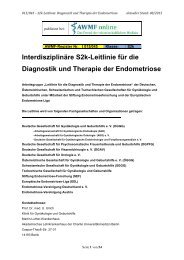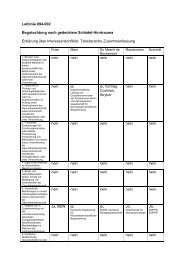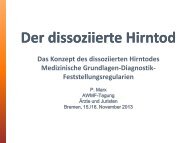Lokaltherapie chronischer Wunden bei Patienten mit den ... - AWMF
Lokaltherapie chronischer Wunden bei Patienten mit den ... - AWMF
Lokaltherapie chronischer Wunden bei Patienten mit den ... - AWMF
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S3-Leitlinie 091-001 „<strong>Lokaltherapie</strong> <strong>chronischer</strong> <strong>Wun<strong>den</strong></strong> <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Risiken CVI, PAVK und Diabetes mellitus“<br />
verabschiedet, zur periodischen Wundreinigung neutrale, wirkstofffreie Lösungen zu<br />
bevorzugen (vgl. S 6 und E 19).<br />
6.7.3. Farbstofflösungen (z. B. Ethacridinlactat, Kaliumpermanganat<br />
u. a.)<br />
Welche Effekte hat eine Wundreinigung <strong>mit</strong> Farbstofflösungen versus keine Wundreinigung<br />
<strong>mit</strong> Farbstofflöungen und im Vergleich <strong>mit</strong> anderen Spüllösungen? Was sind die Effekte in<br />
verschie<strong>den</strong>en Stadien (Granulation, Exsudation)?<br />
Klug E., Seipp H.-M.<br />
Tabelle 21: Farbstofflösungen<br />
Evi<strong>den</strong>z 1 systematische Übersichtsar<strong>bei</strong>t O'Meara et al. 2010 (191)<br />
daraus 1 RCT Geske et al. 2005 (49)<br />
Wirksamkeits- Sämtliche Farbstofflösungen weisen eine vergleichsweise schwache<br />
prinzip<br />
bakterizide Wirkung und ein i. d. R. schmales Wirkspektrum auf.<br />
Darüber hinaus sind sie zytotoxisch, trocknen die Wunde aus und haben<br />
neben der Gefahr der Allergisierung auch ein mutagenes Potential. Schließlich<br />
erschweren sie durch die Verfärbung die Beurteilbarkeit der Wunde (192).<br />
Anwendungshinweise<br />
Die Herstellerangaben sind zu beachten.<br />
Hintergrundtext:<br />
Eine systematische Übersichtsar<strong>bei</strong>t von O'Meara et al. berichtet über eine Studie zur<br />
Wundreinigung <strong>chronischer</strong> venöser Ulcera <strong>mit</strong> Ethacridinlactat versus Placebo (49), <strong>bei</strong>de<br />
Anwendungen wur<strong>den</strong> ergänzt durch Kompressionstherapie. Es zeigte sich hinsichtlich der<br />
Reduktion der Wundfläche ein besseres Abschnei<strong>den</strong> der Ethacridinlactat-Therapie. Die<br />
Evi<strong>den</strong>z ist in der GRADE-Systematik jedoch von geringer Qualität (unklare Angaben zur<br />
Randomisierung und Verblindung, großes Konfi<strong>den</strong>zintervall).<br />
Über Ethacridinlactat wurde erstmals 1921 im Rahmen der Einführung des Produktes<br />
„Rivanol“ berichtet (193). Ausschließlich im Rahmen von Kurzzeituntersuchungen fan<strong>den</strong> sich<br />
geringgradige Nebenwirkungen (194, 195). Da Rivanol zu <strong>den</strong> Acridinen gehört, einer Klasse<br />
die stark an DNA bindet und so <strong>bei</strong> Mikroorganismen Mutationen erzeugt (196-198), besitzt<br />
es das grundsätzliche Potential für genetische Veränderungen und Tumorinduktion auch<br />
<strong>bei</strong>m Menschen, was im Mutagenitätstest belegt ist (199). Auch in der aktuellen<br />
Fachinformation des Herstellers von 2007 (200) wird dazu ausgeführt, dass „bisherige In-<br />
vitro-Untersuchungen an Prokaryonten positiv verliefen und deutliche Hinweise auf ein<br />
mutagenes Potenzial ergaben.“ Dagegen sind lt. Hersteller „Daten zur Resistenzentwicklung<br />
gegen Ethacridinlactat … nicht bekannt“, „Langzeituntersuchungen am Tier auf ein<br />
Seite 102 von 279 aktueller Stand: 12.06.2012