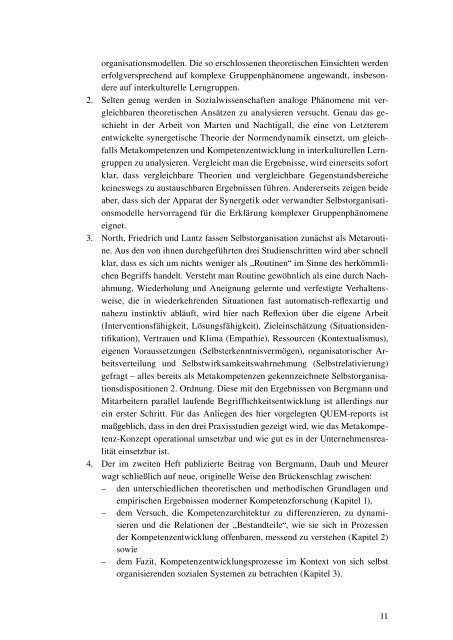Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
organisationsmodellen. Die so erschlossenen theoretischen Einsichten werden<br />
erfolgversprechend auf komplexe Gruppenphänomene angewandt, insbesondere<br />
auf interkulturelle Lerngruppen.<br />
2. Selten genug werden in Sozialwissenschaften analoge Phänomene mit vergleichbaren<br />
theoretischen Ansätzen zu analysieren versucht. Genau das geschieht<br />
in der Arbeit von Marten <strong>und</strong> Nachtigall, die eine von Letzterem<br />
entwickelte synergetische Theorie der Normendynamik einsetzt, um gleichfalls<br />
<strong>Metakompetenzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Kompetenzentwicklung</strong> in interkulturellen Lerngruppen<br />
zu analysieren. Vergleicht man die Ergebnisse, wird einerseits sofort<br />
klar, dass vergleichbare Theorien <strong>und</strong> vergleichbare Gegenstandsbereiche<br />
keineswegs zu austauschbaren Ergebnissen führen. Andererseits zeigen beide<br />
aber, dass sich der Apparat der Synergetik oder verwandter Selbstorganisationsmodelle<br />
hervorragend für die Erklärung komplexer Gruppenphänomene<br />
eignet.<br />
3. North, Friedrich <strong>und</strong> Lantz fassen Selbstorganisation zunächst als Metaroutine.<br />
Aus den von ihnen durchgeführten drei Studienschritten wird aber schnell<br />
klar, dass es sich um nichts weniger als „Routinen“ im Sinne des herkömmlichen<br />
Begriffs handelt. Versteht man Routine gewöhnlich als eine durch Nachahmung,<br />
Wiederholung <strong>und</strong> Aneignung gelernte <strong>und</strong> verfestigte Verhaltensweise,<br />
die in wiederkehrenden Situationen fast automatisch-reflexartig <strong>und</strong><br />
nahezu instinktiv abläuft, wird hier nach Reflexion über die eigene Arbeit<br />
(Interventionsfähigkeit, Lösungsfähigkeit), Zieleinschätzung (Situationsidentifikation),<br />
Vertrauen <strong>und</strong> Klima (Empathie), Ressourcen (Kontextualismus),<br />
eigenen Voraussetzungen (Selbsterkenntnisvermögen), organisatorischer Arbeitsverteilung<br />
<strong>und</strong> Selbstwirksamkeitswahrnehmung (Selbstrelativierung)<br />
gefragt – alles bereits als <strong>Metakompetenzen</strong> gekennzeichnete Selbstorganisationsdispositionen<br />
2. Ordnung. Diese mit den Ergebnissen von Bergmann <strong>und</strong><br />
Mitarbeitern parallel laufende Begrifflichkeitsentwicklung ist allerdings nur<br />
ein erster Schritt. Für das Anliegen des hier vorgelegten QUEM-reports ist<br />
maßgeblich, dass in den drei Praxisstudien gezeigt wird, wie das Metakompetenz-Konzept<br />
operational umsetzbar <strong>und</strong> wie gut es in der Unternehmensrealität<br />
einsetzbar ist.<br />
4. Der im zweiten Heft publizierte Beitrag von Bergmann, Daub <strong>und</strong> Meurer<br />
wagt schließlich auf neue, originelle Weise den Brückenschlag zwischen:<br />
– den unterschiedlichen theoretischen <strong>und</strong> methodischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong><br />
empirischen Ergebnissen moderner Kompetenzforschung (Kapitel 1),<br />
– dem Versuch, die Kompetenzarchitektur zu differenzieren, zu dynamisieren<br />
<strong>und</strong> die Relationen der „Bestandteile“, wie sie sich in Prozessen<br />
der <strong>Kompetenzentwicklung</strong> offenbaren, messend zu verstehen (Kapitel 2)<br />
sowie<br />
– dem Fazit, <strong>Kompetenzentwicklung</strong>sprozesse im Kontext von sich selbst<br />
organisierenden sozialen Systemen zu betrachten (Kapitel 3).<br />
11