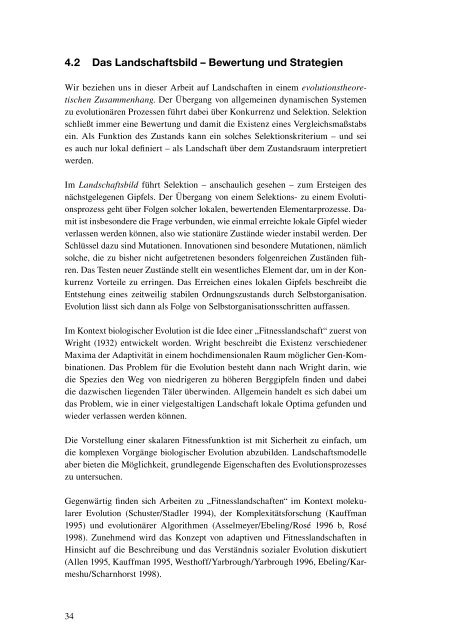Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.2 Das Landschaftsbild – Bewertung <strong>und</strong> Strategien<br />
Wir beziehen uns in dieser Arbeit auf Landschaften in einem evolutionstheoretischen<br />
Zusammenhang. Der Übergang von allgemeinen dynamischen Systemen<br />
zu evolutionären Prozessen führt dabei über Konkurrenz <strong>und</strong> Selektion. Selektion<br />
schließt immer eine Bewertung <strong>und</strong> damit die Existenz eines Vergleichsmaßstabs<br />
ein. Als Funktion des Zustands kann ein solches Selektionskriterium – <strong>und</strong> sei<br />
es auch nur lokal definiert – als Landschaft über dem Zustandsraum interpretiert<br />
werden.<br />
Im Landschaftsbild führt Selektion – anschaulich gesehen – zum Ersteigen des<br />
nächstgelegenen Gipfels. Der Übergang von einem Selektions- zu einem Evolutionsprozess<br />
geht über Folgen solcher lokalen, bewertenden Elementarprozesse. Damit<br />
ist insbesondere die Frage verb<strong>und</strong>en, wie einmal erreichte lokale Gipfel wieder<br />
verlassen werden können, also wie stationäre Zustände wieder instabil werden. Der<br />
Schlüssel dazu sind Mutationen. Innovationen sind besondere Mutationen, nämlich<br />
solche, die zu bisher nicht aufgetretenen besonders folgenreichen Zuständen führen.<br />
Das Testen neuer Zustände stellt ein wesentliches Element dar, um in der Konkurrenz<br />
Vorteile zu erringen. Das Erreichen eines lokalen Gipfels beschreibt die<br />
Entstehung eines zeitweilig stabilen Ordnungszustands durch Selbstorganisation.<br />
Evolution lässt sich dann als Folge von Selbstorganisationsschritten auffassen.<br />
Im Kontext biologischer Evolution ist die Idee einer „Fitnesslandschaft“ zuerst von<br />
Wright (1932) entwickelt worden. Wright beschreibt die Existenz verschiedener<br />
Maxima der Adaptivität in einem hochdimensionalen Raum möglicher Gen-Kombinationen.<br />
Das Problem für die Evolution besteht dann nach Wright darin, wie<br />
die Spezies den Weg von niedrigeren zu höheren Berggipfeln finden <strong>und</strong> dabei<br />
die dazwischen liegenden Täler überwinden. Allgemein handelt es sich dabei um<br />
das Problem, wie in einer vielgestaltigen Landschaft lokale Optima gef<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
wieder verlassen werden können.<br />
Die Vorstellung einer skalaren Fitnessfunktion ist mit Sicherheit zu einfach, um<br />
die komplexen Vorgänge biologischer Evolution abzubilden. Landschaftsmodelle<br />
aber bieten die Möglichkeit, gr<strong>und</strong>legende Eigenschaften des Evolutionsprozesses<br />
zu untersuchen.<br />
Gegenwärtig finden sich Arbeiten zu „Fitnesslandschaften“ im Kontext molekularer<br />
Evolution (Schuster/Stadler 1994), der Komplexitätsforschung (Kauffman<br />
1995) <strong>und</strong> evolutionärer Algorithmen (Asselmeyer/Ebeling/Rosé 1996 b, Rosé<br />
1998). Zunehmend wird das Konzept von adaptiven <strong>und</strong> Fitnesslandschaften in<br />
Hinsicht auf die Beschreibung <strong>und</strong> das Verständnis sozialer Evolution diskutiert<br />
(Allen 1995, Kauffman 1995, Westhoff/Yarbrough/Yarbrough 1996, Ebeling/Karmeshu/Scharnhorst<br />
1998).<br />
34