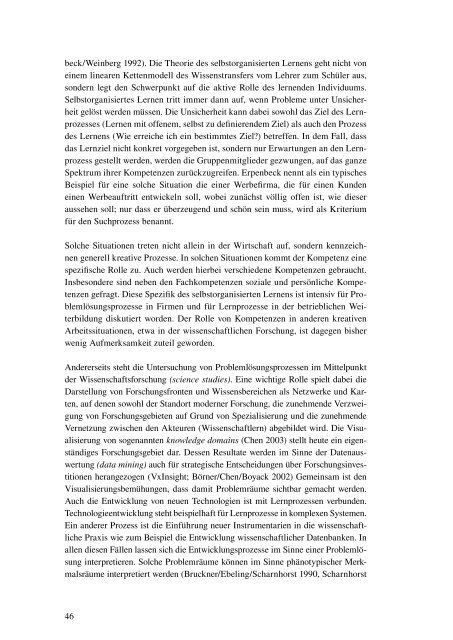Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eck/Weinberg 1992). Die Theorie des selbstorganisierten Lernens geht nicht von<br />
einem linearen Kettenmodell des Wissenstransfers vom Lehrer zum Schüler aus,<br />
sondern legt den Schwerpunkt auf die aktive Rolle des lernenden Individuums.<br />
Selbstorganisiertes Lernen tritt immer dann auf, wenn Probleme unter Unsicherheit<br />
gelöst werden müssen. Die Unsicherheit kann dabei sowohl das Ziel des Lernprozesses<br />
(Lernen mit offenem, selbst zu definierendem Ziel) als auch den Prozess<br />
des Lernens (Wie erreiche ich ein bestimmtes Ziel?) betreffen. In dem Fall, dass<br />
das Lernziel nicht konkret vorgegeben ist, sondern nur Erwartungen an den Lernprozess<br />
gestellt werden, werden die Gruppenmitglieder gezwungen, auf das ganze<br />
Spektrum ihrer Kompetenzen zurückzugreifen. Erpenbeck nennt als ein typisches<br />
Beispiel für eine solche Situation die einer Werbefirma, die für einen K<strong>und</strong>en<br />
einen Werbeauftritt entwickeln soll, wobei zunächst völlig offen ist, wie dieser<br />
aussehen soll; nur dass er überzeugend <strong>und</strong> schön sein muss, wird als Kriterium<br />
für den Suchprozess benannt.<br />
Solche Situationen treten nicht allein in der Wirtschaft auf, sondern kennzeichnen<br />
generell kreative Prozesse. In solchen Situationen kommt der Kompetenz eine<br />
spezifische Rolle zu. Auch werden hierbei verschiedene Kompetenzen gebraucht.<br />
Insbesondere sind neben den Fachkompetenzen soziale <strong>und</strong> persönliche Kompetenzen<br />
gefragt. Diese Spezifik des selbstorganisierten Lernens ist intensiv für Problemlösungsprozesse<br />
in Firmen <strong>und</strong> für Lernprozesse in der betrieblichen Weiterbildung<br />
diskutiert worden. Der Rolle von Kompetenzen in anderen kreativen<br />
Arbeitssituationen, etwa in der wissenschaftlichen Forschung, ist dagegen bisher<br />
wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden.<br />
Andererseits steht die Untersuchung von Problemlösungsprozessen im Mittelpunkt<br />
der Wissenschaftsforschung (science studies). Eine wichtige Rolle spielt dabei die<br />
Darstellung von Forschungsfronten <strong>und</strong> Wissensbereichen als Netzwerke <strong>und</strong> Karten,<br />
auf denen sowohl der Standort moderner Forschung, die zunehmende Verzweigung<br />
von Forschungsgebieten auf Gr<strong>und</strong> von Spezialisierung <strong>und</strong> die zunehmende<br />
Vernetzung zwischen den Akteuren (Wissenschaftlern) abgebildet wird. Die Visualisierung<br />
von sogenannten knowledge domains (Chen 2003) stellt heute ein eigenständiges<br />
Forschungsgebiet dar. Dessen Resultate werden im Sinne der Datenauswertung<br />
(data mining) auch für strategische Entscheidungen über Forschungsinvestitionen<br />
herangezogen (VxInsight; Börner/Chen/Boyack 2002) Gemeinsam ist den<br />
Visualisierungsbemühungen, dass damit Problemräume sichtbar gemacht werden.<br />
Auch die Entwicklung von neuen Technologien ist mit Lernprozessen verb<strong>und</strong>en.<br />
Technologieentwicklung steht beispielhaft für Lernprozesse in komplexen Systemen.<br />
Ein anderer Prozess ist die Einführung neuer Instrumentarien in die wissenschaftliche<br />
Praxis wie zum Beispiel die Entwicklung wissenschaftlicher Datenbanken. In<br />
allen diesen Fällen lassen sich die Entwicklungsprozesse im Sinne einer Problemlösung<br />
interpretieren. Solche Problemräume können im Sinne phänotypischer Merkmalsräume<br />
interpretiert werden (Bruckner/Ebeling/Scharnhorst 1990, Scharnhorst<br />
46