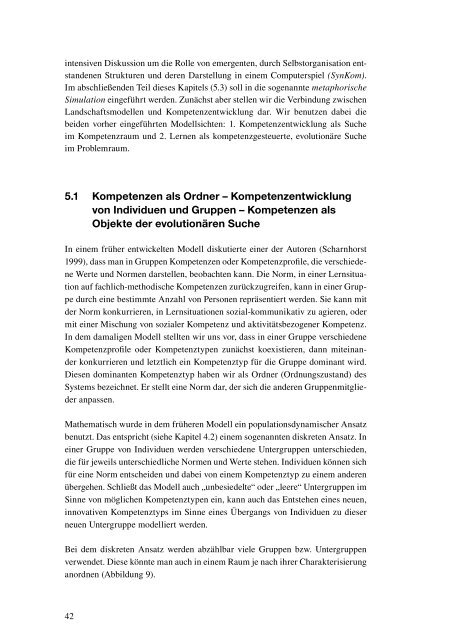Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung - ABWF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
intensiven Diskussion um die Rolle von emergenten, durch Selbstorganisation entstandenen<br />
Strukturen <strong>und</strong> deren Darstellung in einem Computerspiel (SynKom).<br />
Im abschließenden Teil dieses Kapitels (5.3) soll in die sogenannte metaphorische<br />
Simulation eingeführt werden. Zunächst aber stellen wir die Verbindung zwischen<br />
Landschaftsmodellen <strong>und</strong> <strong>Kompetenzentwicklung</strong> dar. Wir benutzen dabei die<br />
beiden vorher eingeführten Modellsichten: 1. <strong>Kompetenzentwicklung</strong> als Suche<br />
im Kompetenzraum <strong>und</strong> 2. Lernen als kompetenzgesteuerte, evolutionäre Suche<br />
im Problemraum.<br />
5.1 Kompetenzen als Ordner – <strong>Kompetenzentwicklung</strong><br />
von Individuen <strong>und</strong> Gruppen – Kompetenzen als<br />
Objekte der evolutionären Suche<br />
In einem früher entwickelten Modell diskutierte einer der Autoren (Scharnhorst<br />
1999), dass man in Gruppen Kompetenzen oder Kompetenzprofile, die verschiedene<br />
Werte <strong>und</strong> Normen darstellen, beobachten kann. Die Norm, in einer Lernsituation<br />
auf fachlich-methodische Kompetenzen zurückzugreifen, kann in einer Gruppe<br />
durch eine bestimmte Anzahl von Personen repräsentiert werden. Sie kann mit<br />
der Norm konkurrieren, in Lernsituationen sozial-kommunikativ zu agieren, oder<br />
mit einer Mischung von sozialer Kompetenz <strong>und</strong> aktivitätsbezogener Kompetenz.<br />
In dem damaligen Modell stellten wir uns vor, dass in einer Gruppe verschiedene<br />
Kompetenzprofile oder Kompetenztypen zunächst koexistieren, dann miteinander<br />
konkurrieren <strong>und</strong> letztlich ein Kompetenztyp für die Gruppe dominant wird.<br />
Diesen dominanten Kompetenztyp haben wir als Ordner (Ordnungszustand) des<br />
Systems bezeichnet. Er stellt eine Norm dar, der sich die anderen Gruppenmitglieder<br />
anpassen.<br />
Mathematisch wurde in dem früheren Modell ein populationsdynamischer Ansatz<br />
benutzt. Das entspricht (siehe Kapitel 4.2) einem sogenannten diskreten Ansatz. In<br />
einer Gruppe von Individuen werden verschiedene Untergruppen unterschieden,<br />
die für jeweils unterschiedliche Normen <strong>und</strong> Werte stehen. Individuen können sich<br />
für eine Norm entscheiden <strong>und</strong> dabei von einem Kompetenztyp zu einem anderen<br />
übergehen. Schließt das Modell auch „unbesiedelte“ oder „leere“ Untergruppen im<br />
Sinne von möglichen Kompetenztypen ein, kann auch das Entstehen eines neuen,<br />
innovativen Kompetenztyps im Sinne eines Übergangs von Individuen zu dieser<br />
neuen Untergruppe modelliert werden.<br />
Bei dem diskreten Ansatz werden abzählbar viele Gruppen bzw. Untergruppen<br />
verwendet. Diese könnte man auch in einem Raum je nach ihrer Charakterisierung<br />
anordnen (Abbildung 9).<br />
42