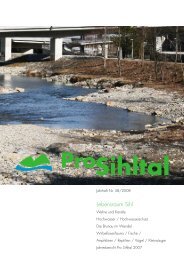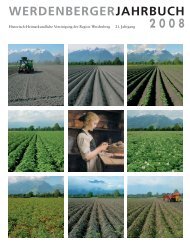Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
100<br />
Europäischer Biber (Castor fiber)<br />
Ordnung: Nagetiere (Rodentia)<br />
Familie: Biber (Castoridae)<br />
Merkmale<br />
Foto: Xaver Roser<br />
Der lateinische Name Castor kommt vom Verb castrare, welches<br />
schneiden bedeutet und somit den Biber als «Schneider»<br />
qualifiziert, was auf die Nagekunst des Tieres anspielt.<br />
Der Biber kann bis zu 1.4 m lang, 35 kg schwer und bis 20<br />
Jahren alt werden. Sein braunes Fell ist mit 23`000 Haaren<br />
pro Quadratzentimeter sehr dicht und schützt vor Nässe und<br />
Auskühlung. Der Pelz wird überdies mit einem fetthaltigen<br />
Sekret, dem Bibergeil, gepflegt. Weiters ist der unbehaarte<br />
Schwanz - die Kelle -, welche als Steuer beim Abtauchen<br />
dient, ein typisches Merkmal des Bibers. Biber können 15-20<br />
Minuten unter Wasser tauchen.<br />
Biologie<br />
Biber leben in Einehe. Das Revier einer Biberfamilie, die<br />
aus dem Elternpaar und bis zwei Generationen von Jungtieren<br />
besteht, umfasst 1-3 Kilometer Fliessgewässerstrecke.<br />
In der Biberburg leben die Altbiber mit bis zu vier Jungen.<br />
Im Mai wird der behaarte und von Geburt an sehende<br />
Nachwuchs geboren. Sie werden von der Mutter zwei Monate<br />
gesäugt und erlangen nach drei Jahren die Geschlechtsreife.<br />
Sie werden dann von den Eltern aus dem Revier<br />
vertrieben und können über 100 Kilometer weit<br />
wandern.<br />
Im Biberrevier finden sich in der Regel 2-4 Wohnbaue unterschiedlicher<br />
Form. Dies kann in der Uferböschung als<br />
Höhle angelegt sein, wobei der Eingang zum Wohnkessel<br />
immer unter Wasser liegt. Die eigentliche Biberburg besteht<br />
aus abgenagten Ästen; Zweigen und Schlamm. Auch<br />
hier liegt der Eingang meist unter Wasser, was gegen Feinde<br />
schützt. Biber sind auch für den Dammbau bekannt, mit<br />
denen sie Fliessgewässer aufstauen und Teiche anlegen.<br />
Dadurch ertränken sie den umgebenden Waldbestand, die<br />
Bäume sterben allmählich ab. Diese Regulierung gibt den<br />
Bibern den geeigneten Wasserstand rund um die Burg. Sie<br />
holzen, indem sie die Bäume rundum benagen. Ein Biber<br />
kann in einer Nacht einen bis zu 50 cm dicken Baum fällen.<br />
Sie halten keinen Winterschlaf.<br />
Verbreitung<br />
Der Europäische Biber war ursprünglich in Europa und weiten<br />
Teilen Asiens heimisch, wurde dann aber durch Bejagung<br />
(Fell, Fleisch als Fastenspeise) in weiten Teilen Europas ausgerottet.<br />
Er kam auch einst im Alpenrheintal vor. Wir finden<br />
entsprechende Hinweise in den Abfällen auf den prähistorischen<br />
Siedlungsplätzen des Eschner Lutzengüetle (HARTMANN-<br />
FRICK 1959) wie auch auf dem Borscht (Schellenberg), und dies<br />
bis in die frühe Bronzezeit (HARTMANN-FRICK 1964). Auch die<br />
Römer jagten den Biber vor allem des Felles und des Bibergeils<br />
willen, wie die Funde von Tierknochen im spätrömischen<br />
Kastell in Schaan belegen (WÜRGLER 1958). In den ausgewerteten<br />
Tierknochenfunden vom 13./14. Jahrhundert von der<br />
Burg Neu-Schellenberg sind hingegen keine Biber-Knochenreste<br />
mehr belegt (SCHUELKE 1965). Angaben aus dem Mittelalter<br />
gibt es noch von der Bodenseenähe (BRUHIN 1868, DALLA<br />
TORRE 1887). In der «Embser Chronik» 1616 (Hystorischen Relation<br />
oder Eygendtliche Beschreibung der Landschaft underhalb<br />
St.Lucis Stayg und dem Schallberg beyerseits Rheins<br />
biss an den Bodensee von Johann Georg Schleh) wird der<br />
Biber nicht mehr als jagdbares Wild dargestellt. MÜLLER &<br />
JENNY (2005) meinen, dass der Biber bis ins 17. Jahrhundert<br />
das Alpenrheintal besiedelte. GIRTANNER (1885) schreibt, dass<br />
der Biber bis ins 16. Jahrhundert ein uns allbekanntes Tier gewesen<br />
sei, wobei wir über sein allmähliches Verschwinden im<br />
Laufe der Jahrhunderte sozusagen nichts wüssten. In der<br />
Nähe von Rheineck (SG) befände sich noch der Flurname «Biberhölzli».<br />
Die Ausrottung der Biber in der Schweiz wird<br />
meist mit anfangs des 19. Jahrhunderts angegeben.<br />
Seit 1956 wird der Biber in der Schweiz wieder angesiedelt,<br />
bis 1977 wurden insgesamt 141 Tiere ausgesetzt, vor allem in<br />
der Westschweiz und im Thurgau. Bei der Erhebung 1978<br />
fanden sich noch 130 Tiere, im Jahre 1993 wurde der Bestand<br />
auf 350 Tiere geschätzt, jetzt leben gemäss einer im Winter<br />
2007/2008 durchgeführten Erhebung in der Schweiz wieder<br />
1600 Tiere (www.news.admin.ch). Der Biber kommt heute<br />
entlang der grossen Flüsse und Seen vom Genfer- bis zum Bodensee<br />
fast im ganzen Mittelland sowie entlang der Rhône<br />
im Wallis vor. Der Bestand entwickelte sich also äusserst positiv.<br />
Heute sollen 1400 Kilometer Fliessgewässer besiedelt<br />
sein, wobei sich über 40% der Reviere an Bächen oder kleineren<br />
Seen und Teichen mit einer Fläche von weniger als<br />
einer Hektare befinden.<br />
Es war darum nur eine Frage der Zeit bis der expandierende<br />
Biber ausgehend von der Schweizer Population wieder ins Alpenrheintal<br />
vordringt. Im Jahre 1968 wanderte das Bibermännchen<br />
«Haakon» die 120 Kilometer von Bottighofen<br />
(Thurgau) bis nach Grüsch (GR) im Prättigau und wurde dort<br />
am 18. Juni 1968 in der «Chlus» überfahren. In RAHM (1995)<br />
wird von einem Bibernachweis im Alten Rhein bei Rorschach<br />
gesprochen. Dort setzte sich beim «Eselschwanz» der Biber<br />
als erstes im Alpenrheintal fest. Mitte Mai 2008 wird erstmals<br />
von einem Biber im Binnenkanal berichtet (pers.Mitt. Xaver<br />
Roser, Ruggell vom 3.8.2010). Am 15. Juni 2008 sieht Georg<br />
Willi im untersten <strong>Liechtenstein</strong>er Binnenkanal einen<br />
schwimmenden Biber. Nagespuren an Gehölzen konnten<br />
durch den Autoren im Herbst/Winter 2008/2009 entlang des<br />
<strong>Liechtenstein</strong>er Binnenkanals unterhalb von Ruggell bestä-