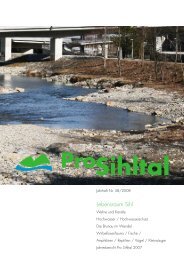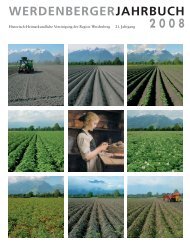Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verbreitung<br />
In Europa ist die Kleine Hufeisennase einzig im Mittelmeergebiet<br />
weit verbreitet. In Mittel- und Westeuropa erstreckt<br />
sich das Vorkommen, mit grossen Verbreitungslücken,<br />
gegen Norden bis nach West-Irland und das südwestliche<br />
Grossbritannien. Ausserhalb Europas reicht die Verbreitung<br />
von Teilen Nord- und Ostafrikas sowie der Arabischen Halbinsel<br />
ostwärts in Asien bis Kaschmir. In der Schweiz beschränkt<br />
sich das Vorkommen der Kleine Hufeisennase,<br />
nachdem sie hier bis vor 50 Jahren noch weit verbreitet war,<br />
auf isolierte Kolonien in wenigen Alpentälern. In unmittelbarer<br />
Nachbarschaft <strong>Liechtenstein</strong>s existieren im Alpen -<br />
rhein tal nur noch je eine Wochenstube in der Bündner Herrschaft<br />
(MÜLLER et al. 2010) und im Sarganserland (Seeztal)<br />
(GÜTTINGER & BARANDUN 2010). In Voralberg sind je eine Wochenstube<br />
im Rheintal und Grosswalsertal sowie mehrere<br />
Kolonien im Bregenzerwald bekannt (REITER et al. 2006). In<br />
<strong>Liechtenstein</strong> ist die Kleine Hufeisennase letztmals 1953 in<br />
Vaduz beobachtet worden (VON LEHMANN 1962; WIEDEMEIER<br />
1984).<br />
Lebensraum<br />
Wochenstubenquartiere der Kleinen Hufeisennase befinden<br />
sich in Kirchen, Kapellen, Burgen, Wohnhäusern, Ställen,<br />
Brücken und Kraftwerksgebäuden. Die Art bevorzugt verwinkelte,<br />
oft aus mehreren Teilräumen bestehende Dachböden<br />
mit zugluftfreiem und warmem Mikroklima. Den Winterschlaf<br />
verbringt sie in Höhlen und Stollen.<br />
Die Kleine Hufeisennase jagt im Wald. Im Vorderrheintal<br />
(Lugnez, Kanton Graubünden) nutzt sie verschiedene Waldtypen<br />
bis auf 1500 m Meereshöhe (BONTADINA et al. 2006). Oft<br />
sucht sie ihre Beute im Bereich von Fliessgewässern. Auf dem<br />
Weg zwischen Tagesquartier und Jagdgebiet fliegt die Kleine<br />
Hufeisennase gerne entlang von Hecken, Baumreihen,<br />
Geländekanten und Gebäuden. Vermutlich erhöht das Vorhandensein<br />
solcher Deckungsstrukturen die Chance eines sicheren,<br />
vor Fressfeinden geschützten Ausflugs. Gleichzeitig<br />
können die Fledermäuse früher in der Dämmerung ausfliegen,<br />
so dass ihnen mehr Zeit für die Beutesuche bleibt. Der<br />
Aktionsradius um das Wochenstubenquartier beträgt im<br />
Normalfall etwas 2,5 km und reicht im Maximum bis 4 km.<br />
Bei der Wahl von Ruhequartieren während der Jagdpausen<br />
ist die Kleine Hufeisennase wenig wählerisch. In Frage kommen<br />
alte Ställe, Felsspalten, Brücken sowie Betonschächte<br />
und Strassenunterführungen von Bächen.<br />
Gefährdung und Schutz<br />
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlitt die Kleine<br />
Hufeisennase in Mittel- und Westeuropa einen umfassenden<br />
Bestandesrückgang, verbunden mit einem grossräumigen<br />
Arealverlust. Hauptursache dafür sind nach heutiger Auffassung<br />
hochtoxische Pestizide wie DDT und Lindan, welche damals<br />
in der Landwirtschaft und bei der Schädlingsbekämpfung<br />
in Dachstöcken bedenkenlos eingesetzt wurden. Die<br />
Aufnahme der Wirkstoffe über die Nahrungskette und den<br />
Kontakt mit behandeltem Holz im Quartier führte zu einer<br />
schleichenden Vergiftung der empfindlichen Fledermäuse. In<br />
<strong>Liechtenstein</strong> ist die Kleine Hufeisennase seit über 50 Jahren<br />
ausgestorben. Systematische Dachstockkontrollen, wie sie<br />
seit den 1990er Jahren regelmässig durchgeführt werden, erbrachten<br />
bislang keine Hinweise auf ein aktuelles Vorkommen.<br />
Erstaunlicherweise sind auch ältere Beobachtungen nur<br />
spärlich vorhanden. Einzig VON LEHMANN (1962, zit. in WIEDE-<br />
MEIER 1984) erwähnt zwei Beobachtungen von 1953 aus<br />
Vaduz, nämlich eine Wochenstube mit rund 20 Alttieren in<br />
einem Dachstock sowie ein Einzeltier in einem Keller.<br />
In Graubünden sowie im Bregenzerwald zeigen die verbliebenen<br />
Wochenstubenkolonien der Kleinen Hufeisennase<br />
seit Jahren eine positive Bestandesentwicklung (REITER et al.<br />
2006, MÜLLER et al. 2010). Dieser Trend lässt auf eine Wiederausbreitung<br />
und mittelfristig auch auf eine erneute Besiedlung<br />
<strong>Liechtenstein</strong>s hoffen. Das Öffnen verschlossener<br />
Dachstöcke, welche idealerweise nicht weiter als 2 bis 3 km<br />
vom Wald entfernt liegen sollten, ist eine wichtige Massnahme<br />
zur Wiederherstellung potenzieller Wochenstubenquartiere.<br />
Ebenfalls wesentlich ist das Vorhandensein von<br />
Hecken und Baumreihen als Deckungsstrukturen entlang<br />
der Flugrouten zwischen Quartier und Jagdgebieten. An geeigneten<br />
Orten angepflanzt, werden neue Hecken von den<br />
Tieren sehr rasch angenommen. Eine möglichst grosse Waldfläche<br />
im Umkreis von 600 m um das Wochenstubenquartier<br />
erhöht die Lebensraumqualität massgeblich.<br />
René Güttinger<br />
Abb. 66 Im Rheinbergerhaus in Vaduz hat der Zoologe Ernst von<br />
Lehmann 1953 letztmals eine zwanzigköpfige Kolonie der Kleinen<br />
Huf eisennase beobachtet. (Foto: Silvio Hoch)<br />
53