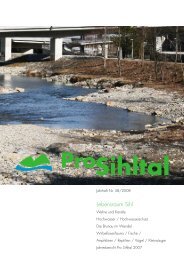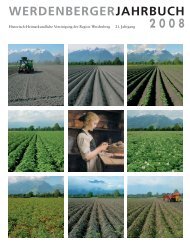Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verbreitung<br />
Das Grosse Mausohr ist in ganz Südeuropa (mit Ausnahme<br />
einzelner Mittelmeerinseln) sowie in weiten Teilen West-,<br />
Mittel- und Osteuropas verbreitet. Die Verbreitungsgrenze<br />
verläuft nördlich durch das südlichste Grossbritannien,<br />
Schleswig-Holstein, Südschweden und Nordpolen sowie östlich<br />
von der westlichen Ukraine bis zum Schwarzen Meer. In<br />
Kleinasien reicht die Verbreitung bis zum Kaukasus und den<br />
nahen Osten. Im Alpenrheintal (inklusive der Seitentäler)<br />
sind insgesamt 11 Wochenstubenquartiere bekannt (MÜLLER<br />
et al. 2010, REITER, mündl. Mitteilung, GÜTTINGER UND HOCH<br />
2010). Diese liegen auf schweizerischem (7), österreichischem<br />
(3) sowie liechtensteinischem Gebiet (1). Die einzige<br />
Wochenstube <strong>Liechtenstein</strong>s lebt – gemeinsam mit dem<br />
noch selteneren Kleinen Mausohr – als Mischkolonie in der<br />
Pfarrkirche Triesen. Wenige weitere Nachweise betreffen ein<br />
Paarungsquartier aus Triesenberg, zwei Männchen-Sommerquartiere<br />
aus Triesenberg, je ein Männchenquartier aus<br />
Vaduz und Mauren sowie mehrere Nachtruhequartiere aus<br />
Triesen und Balzers (HOCH, schriftl. Mitteilung). (Karte siehe<br />
Kleines Mausohr)<br />
Lebensraum<br />
Das Grosse Mausohr ist ein Tieflandbewohner, dessen Wochenstubenquartiere<br />
meist unterhalb 1000 m Meereshöhe<br />
liegen. In Südeuropa nutzt die Art als Wochenstubenquartiere<br />
vorwiegend grossräumige, unterirdische Räume wie<br />
Felshöhlen. In Mitteleuropa und den Alpenländern bewohnen<br />
Wochenstubenverbände jedoch hauptsächlich Gebäude<br />
sowie gelegentlich auch Brücken. Dabei werden grosse, dunkle<br />
und zugfreie Räume bevorzugt. Wenige Kubikmeter<br />
grosse Räume sowie Spaltquartiere sind die Ausnahme.<br />
Männchen zeigen als Einzelgänger eine flexiblere Quartierwahl<br />
und besiedeln sowohl Dachstühle, Spalträume an<br />
Gebäuden (Zwischendächer, Rolladenkästen), Spalten in<br />
Brücken, Fledermauskästen und Baumhöhlen. Als Winterquartiere<br />
dienen Höhlen, Stollen und andere unterirdische<br />
Hohlräume.<br />
Das Spektrum an Jagdlebensräumen ist breit und reicht von<br />
unterholzfreien Wäldern (Laub-, Laubmisch- und Nadelwälder)<br />
bis zu frisch abgemähten Wiesen, frisch bestossenen<br />
Weiden sowie erst kürzlich abgeernteten Ackerflächen. Entsprechend<br />
seiner bevorzugten Jagdstrategie jagt das Grosse<br />
Mausohr praktisch nur auf Flächen, bei denen es Beutetiere<br />
ungehindert vom Boden aufnehmen kann. Als nächtliche<br />
Ruheplätze, welche das Grosse Mausohr in den Jagdpausen<br />
aufsucht, dienen zum Beispiel Gebäude in der Nähe der<br />
Jagdgebiete, häufiger jedoch Gebüschgruppen, Fichtenschonungen<br />
und Baumhöhlen im Wald. In der Ostschweiz beträgt<br />
die nachgewiesene Entfernung zwischen Jagdgebiet<br />
und Wochenstubenquartier über 17 km. Die Jagdgebiete<br />
verteilen sich dabei von den Tieflagen bis auf 1400 m ü. M.<br />
(GÜTTINGER 1997).<br />
Gefährdung und Schutzmassnahmen<br />
Das Grosse Mausohr besiedelt Wochenstubenquartiere über<br />
Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinweg Jahr für Jahr.<br />
Diese ausgeprägte Quartiertreue erstreckt sich über Generationen,<br />
indem ein Grossteil der Weibchen zur Fortpflanzung<br />
jeweils wieder an ihren Geburtsort zurückkehrt. Die grösste<br />
Gefährdung erfahren die Kolonien durch unsachgemässe<br />
Dachstocksanierungen. Das Beispiel der umfangreichen Sanierung<br />
und Erweiterung der Pfarrkirche Triesen von 1991<br />
bis 1994 ist ein «Lehrbuchbeispiel» dafür, dass bei frühzeitigem<br />
Einbezug von Fledermausfachpersonen in die Planung<br />
selbst mehrjährige Sanierungen fledermausfreundlich<br />
durchgeführt werden können. So hat das bedeutendste<br />
Fledermausquartier <strong>Liechtenstein</strong>s die umfangreiche Renovierung<br />
dank zahlreicher flankierender Massnahmen schadlos<br />
überstanden (GÜTTINGER et al. 1994).<br />
Wegen ihrer spezifischen Ansprüche an die Struktur der<br />
Jagdlebensräume (Jagd am Boden) ist das Grosse Mausohr<br />
äusserst verwundbar gegenüber Veränderungen in der Kulturlandschaft.<br />
Eine wichtige Massnahmen zur Lebensraumoptimierung<br />
ist die Förderung hallenwaldartiger Waldbestände<br />
durch Erhöhung des Buchenanteils sowie auf<br />
wüchsigen Buchenwaldstandorten die Rückführung der<br />
künstlichen Fichtenforste in naturnahe Wälder. Geht man<br />
davon aus, dass gerade im Alpenraum zahlreiche Waldflächen<br />
durch Nutzungsaufgabe allmälich verbuschen, so wird<br />
sich für das Grosse Mausohr das Lebensraumangebot im<br />
Wald mittelfristig vermindern. Als rasch wirksame Gegenmassnahme<br />
wäre abzuklären, ob in derart unternutzten Flächen<br />
mit einer kontrollierten Waldweide neue potenzielle<br />
Jagdlebensräume geschaffen werden könnten. Für das Grosse<br />
Mausohr ähnlich problematisch ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen<br />
Nutzung von Wiesen und Weiden und der<br />
daraus resultierende Verlust an kurzgrasigen Flächen. Hier<br />
sollte alles unternommen werden, um zumindest die traditionell<br />
bewirtschafteten Magerweiden zu erhalten.<br />
René Güttinger<br />
Abb. 73 Hallenartige Buchenmischwälder mit geringem oder fehlendem<br />
Unterwuchs zählen zu den wichtigsten Jagdlebensräumen des Grossen<br />
Mausohrs. (Foto: René Güttinger)<br />
59