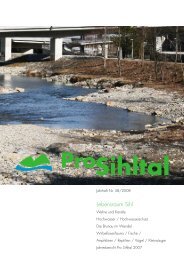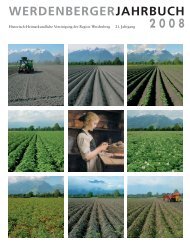Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stände der Sicherung des Waldnachwuchses künftig absolute<br />
Priorität eingeräumt werden (NIGSCH 2009). Anderseits ist<br />
es wichtig, dass innerhalb des Waldes offene oder halboffene<br />
Flächen bestehen, wo ausreichend Licht auf den Waldboden<br />
gelangen kann und dadurch genügend pflanzliche Biomasse<br />
auch als Futter für die Pflanzenfresser zur Verfügung<br />
steht. In einem Wald mit geschlossenem Kronendach und<br />
ungenügendem Lichteinfall befindet sich die grüne Biomasse<br />
und damit auch das nutzbare Futter der Pflanzenfresser<br />
unerreichbar in den Kronen der Waldbäume. Entsprechende<br />
Massnahmen wurden von den Gemeindeförstern in den letzten<br />
zehn bis fünfzehn Jahren grossflächig durchgeführt. Für<br />
den Schutz der Wildtiere ist die Einrichtung von Wildruhezonen<br />
künftig unabdingbar.<br />
3.3 Die Grenzen der Jagd und des Jägers<br />
Vor allem bei der Jagd auf den Rothirsch stossen die Jäger<br />
heute an ihre Grenzen. Durchschnittlich werden in <strong>Liechtenstein</strong><br />
jährlich 85% der im Rahmen der Nachtaxation im Spätwinter<br />
erhobenen Rothirschbestände jagdlich abgeschöpft.<br />
26 Stück Rotwild werden pro 1‘000 Hektar Rotwildlebensraum<br />
erlegt. In Vorarlberg liegt diese Zahl bei 15 Stück, in<br />
Graubünden bei 6 Stück (NÄSCHER 2009). Obwohl sehr hohe<br />
Abschusszahlen seit Jahren erfüllt werden (Durchschnitt 211<br />
Stück pro Jahr seit 1993) und dadurch das Standwild in<br />
<strong>Liechtenstein</strong> mehr oder weniger schon abgeschöpft wurde,<br />
wird der Rothirschbestand durch Zuwanderung aus dem benachbarten<br />
Vorarlberg jedes Jahr wieder aufgestockt. In<br />
Vorarlberg wird das Rotwild noch immer durch Intensivfütterung<br />
durch den Winter gebracht und der Kälberzuwachs<br />
wird jagdlich nicht abgeschöpft. Die hohen Abschüsse beim<br />
Schalenwild erfordern sehr viel Präsenzzeit des Jägers im<br />
Revier. Die intensive Bejagung wird damit auch zu einem<br />
bedeutenden Störfaktor für das Wild. Zusammen mit den<br />
Störungseinflüssen der nichtjagenden Bevölkerung wird dadurch<br />
die Scheuheit der Wildtiere erhöht und die Bejagung<br />
immer mehr erschwert und in die Dämmerungszeit der<br />
Nacht verschoben. In dieser Teufelsspirale stösst die Jagd bei<br />
ihrer Pflicht zur Erfüllung der vorgegebenen Abschusszahlen<br />
an ihre Grenzen.<br />
Seit 2010 wird in <strong>Liechtenstein</strong> und in den benachbarten Gebieten<br />
Graubündens und Vorarlbergs das Wanderverhalten<br />
der Rothirsche durch Markierung und Besenderung untersucht,<br />
um Klarheit über die grenzüberschreitenden Wechselbeziehungen<br />
zu erhalten und zielführende Massnahmen<br />
treffen zu können.<br />
3.4 Warum jagen?<br />
Die Jagd auf wildlebende, jagbare Tiere ist eine Tätigkeit,<br />
die tief in der Geschichte der Menschheit verankert ist. In<br />
der heutigen modernen Zeit mag die Jagd für viele Menschen<br />
als überholtes, archaisches Überbleibsel aus vergangenen<br />
Zeiten gelten. Heute spricht man eher von Wildtiermanagement<br />
und beschafft sich das nötige Wissen über<br />
Wildtiere bei Google und aus Fernsehfilmen. Eine zuneh-<br />
mende Vermenschlichung des Tieres und damit verbundenes<br />
Mitleid ist feststellbar. Viele Menschen haben Abstand genommen<br />
wenn es darum geht, Tiere zu töten um sie zu<br />
essen. Der Jäger gibt sich dieser Aufgabe hin und versucht<br />
auf zeitgerechte, moderne Weise die Bestände von jagdbaren<br />
Wildtieren artgerecht zu nutzen und zu regulieren. Er<br />
verbringt viel Zeit im Revier und sammelt dabei praktische<br />
Erfahrung und Wissen über den Ort, wo er jagt. Eine Art<br />
Ehrenkodex existiert in Form der traditionellen und über<br />
viele Jägergenerationen überlieferten Begriffe «Weidgerechtigkeit»<br />
und «Hege». Jäger lernen während der gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Ausbildung und mit dem von erfahrenen<br />
Kollegen weiter gegebenen Wissen, wie die Jagd mit<br />
dem nötigen Respekt gegenüber der Natur und zur Förderung<br />
und Erhaltung der Wildtierbestände und derer Lebensräume<br />
ausgeübt wird. Diese Aufgabe ist sehr anspruchsvoll,<br />
weil bei jeder Wildart und in jedem Wildlebensraum andere<br />
Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen. Jäger<br />
jagen aus Freude an der Jagd und nicht in erster Linie aus<br />
dem Pflichtgefühl heraus, dass kranke und schwache Tiere<br />
aus der Wildbahn entnommen werden müssen. Dabei ist die<br />
Suche nach möglichst grossen Trophäen nicht Bestandteil<br />
von Weidgerechtigkeit und Hege. Die Jagd kann nur dann<br />
nachhaltig sein, wenn Wildbestände und deren Lebensräume<br />
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Die Regulierung<br />
von Wildbeständen ist deshalb eine wichtige öffentliche<br />
Aufgabe, die der Jäger unentgeltlich erfüllt und über<br />
den Jagdpachtschilling sowie seine persönlichen Ausgaben<br />
auch noch bezahlt. Für die moderne Entwicklung der Jägerei<br />
ist es wichtig, dass sich die Jäger nach ökologischen<br />
Grundsätzen ausrichten. Diese Forderung gilt jedoch für alle<br />
Naturnutzer, nicht nur für die Jäger.<br />
Michael Fasel<br />
Abb. 13 Das Reh wird neben dem Hirsch in <strong>Liechtenstein</strong> am stärksten<br />
bejagt. (Foto: Xaver Roser)<br />
15