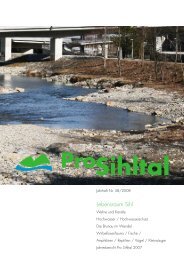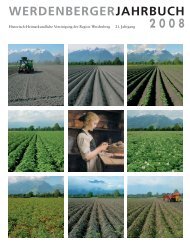Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tigt werden. Der erste Pressehinweis stammt vom 5.11.2008<br />
(Liecht. Vaterland). Hinweise aus dem gleichen Jahr stammen<br />
auch aus dem Naturschutzgebiet Loo/Wichenstein in Oberriet<br />
(SG) (<strong>Liechtenstein</strong>er Vaterland, 12. August 2008). Am 6.<br />
April 2009 meldet das liechtensteinische Presseportal, dass<br />
dem Wildhüter Wolfgang Kersting vom Amt für Wald, Natur<br />
und Landschaft ein ausgewachsener Biber in die Fotofalle gegangen<br />
sei (Liecht. Volksblatt und Liecht. Vaterland vom<br />
7.4.2009). Xaver Roser aus Ruggell schreibt im Ruggeller Informationsblatt<br />
«Nordwind» vom Dezember 2009, dass er im<br />
Binnenkanal drei Biber gesehen habe, darunter ein Jungtier.<br />
Kurz darauf gelang es dem Grabser Wildhüter Peter Eggenberger<br />
auf der Schweizer Seite im Bereich Haag-Buchs zwei<br />
Exemplare zu fotografieren (<strong>Liechtenstein</strong>er Vaterland vom<br />
15. April 2009). Die Biberpopulation scheint sich an diesen<br />
beiden Standorten zu stabilisieren. Spuren sind inzwischen<br />
auch im Schaaner Riet an der Grenze zu Gamprin und Eschen<br />
bis nach Vaduz entdeckt worden. Der Biber hat sich inzwischen<br />
in Ruggell auch fortgepflanzt, wobei Xaver Roser<br />
(pers. Mitt.) meint, dass die Jungen durch das Hochwasser im<br />
Jahr 2009 umgekommen seien. Die gleiche Beobachtung<br />
wird auch von der Schweizer Seite gemacht. 2010 findet hingegen<br />
eine erfolgreiche Reproduktion mit zumindest einem<br />
Jungtier in Ruggell statt (Xaver Roser pers. Mitt.).<br />
Abb. 123 Die Verbreitungskarte zeigt die Ausbreitung des<br />
Bibers entlang der Gewässer <strong>Liechtenstein</strong>s.<br />
2 1 0Kilometer<br />
Lebensraum<br />
Die vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Biber ruhen<br />
tagsüber in ihrem Bau. Sie hinterlassen ihre typischen Spuren<br />
mit den Bauen, Nagespuren, Ausstiege, Dämme, Trittsiegel.<br />
Das semiaquatische Tier beansprucht neben Gewässern auch<br />
Uferbereiche mit Nahrung in unmittelbarer Gewässernähe<br />
(bis ca. 20 m vom Gewässerrand). Die Gewässer sollten langsam<br />
fliessend sein. Am geeignetsten sind unverbaute, naturnahe<br />
Uferbereiche, Auengebiete, Seen im Tiefland. Sind die<br />
Weichhölzer übernutzt, so zieht der Biber weiter, bis sie vielleicht<br />
wenige Jahre später einem Biber wieder als Lebensgrundlage<br />
dienen. Biber-Lebensräume erfahren einen deutlichen<br />
Anstieg an Artenvielfalt. Für zahlreiche Tier- und<br />
Pflanzenarten eröffnen sich erst nach Biberaktivitäten geeignete<br />
Lebensräume, beispielsweise amphibien- und fischreiche<br />
Gewässer. In unseren Breiten profitieren davon auch der<br />
Laubfrosch, die Libellen und Eisvogel im besonderen Masse.<br />
Gefährdung und Schutzmassnahmen<br />
Der Biber ist in der Schweiz durch das Jagdgesetz geschützt.<br />
Er ist dort auf der Roten Liste als «vom Aussterben gefährdet»<br />
angegeben. Zumindest bis zur nächsten Revision behält<br />
er diesen Status. In der österreichischen Roten Liste 2005 gilt<br />
er als nicht gefährdet, in der Vorarlberger Roten Liste gilt er<br />
als ausgestorben (SPITZENBERGER 2006).<br />
Bereits wird über Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen<br />
geklagt. Doch sind nennenswerte Schäden bisher ausgeblieben,<br />
die Frassschäden in der Schweiz belaufen sich im langjährigen<br />
Durchschnitt auf rund 5‘000 Franken. Die Summe<br />
der Bagatellschäden wird auf ca. 50‘000 Franken im Jahr geschätzt<br />
(Gregor Klaus, Rückkehr eines Landschaftsarchitekten,<br />
NZZ 30. Juli 2010). Immerhin gab es im Thurgau Ende der<br />
1980er Jahren schon einen «Biberkrieg» mit Konflikten zwischen<br />
der Land- und Forstwirtschaft und dem Naturschutz.<br />
Ein beidseitiger 10-15 m breiter Uferstreifen reicht nach bisheriger<br />
Kenntnis aus, um Konflikte zu minimieren. Allzu<br />
häufig liegen heute aber landwirtschaftliche Kulturen direkt<br />
neben dem Wasserlauf. Es braucht also – und nicht nur zum<br />
Biberschutz – mehr Raum für die Gewässer, damit diese ihre<br />
ökologische Funktion erfüllen und bei Hochwasser den Abfluss<br />
auch wirksam bremsen können.<br />
Mario F. Broggi<br />
Abb. 124 Erstnachweis des Bibers im Jahres 2009 in der<br />
Fotofalle. (Foto: AWNL)<br />
101