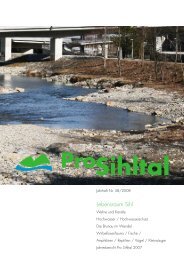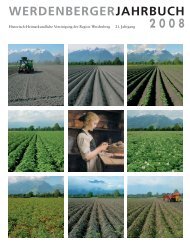Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
172<br />
Alpensteinbock (Capra ibex)<br />
Ordnung: Paarhufer (Artiodactyla)<br />
Familie: Hornträger (Bovidae)<br />
Merkmale<br />
Foto: Markus Stähli<br />
Der gedrungene Körperbau mit stämmigen, kurzhufigen<br />
Beinen, kurzem Schwanz, verhältnismässig kurzem Kopf mit<br />
aufgewölbter Stirn zeigt deutlich die Ziegenverwandtschaft.<br />
Steintiere sind ausgesprochen gut angepasst an das Klettern in<br />
steilem Fels. Die hartrandigen und gut spreizbaren paarigen<br />
Hufe ermöglichen einen guten Halt auf abschüssigem Fels und<br />
wirken wie Schneeschuhe im tiefen Schnee. Die Geissen<br />
werden 40 bis 50 kg, die Böcke bis zu 140 kg schwer. Bei allen<br />
Bovidenarten tragen sowohl Weibchen wie Männchen Hörner.<br />
Die des Steinbockes können bis zu einem Me ter, die der Steingeiss<br />
bis etwa 30 Zentimeter lang werden. Weil Hörner nicht<br />
wie bei Cerviden jährlich abgeworfen werden, sondern lebenslang<br />
weiterwachsen, bilden sich während des Wachstumsstillstands<br />
im Winter Jahrringe, die die genaue Altersbestimmung<br />
ermöglichen. Beim Bock kann aufgrund der markanten<br />
Knoten des Gehörns, von denen in der Regel zwei pro Jahr gebildet<br />
werden, das Alter auch auf Distanz relativ genau geschätzt<br />
werden (Anzahl Knoten dividiert durch 2 plus 1=Alter).<br />
Das im ersten Lebensjahr gebildete Kitzgehörn wird mit zunehmendem<br />
Alter immer mehr abgeschabt und ist an den<br />
Hörnern alter Tiere kaum mehr feststellbar. Das aus 32 Zähnen<br />
bestehende Dauergebiss trägt im Oberkiefer wie bei allen<br />
Wiederkäuern keine Schneidezähne. Bau, Form und Stellung<br />
der Zähne sind grundsätzlich gleich wie bei der Gämse. Das<br />
dichte, raue Fell trägt im Winter längere Haare und eine<br />
dichtere Unterwolle als im Sommer. Während des Frühlings<br />
fallen die Haare in grossen Büscheln aus, wenn der Steinbock<br />
sich an Zwergsträuchern und am Boden kratzt und schürt. Die<br />
Neubildung des Haarkleides erfolgt einmal im Jahr und beginnt<br />
im Sommer. Bis in den Spätherbst wachsen auch die<br />
Woll- und Deckhaare des Winterfells durch die Sommerhaare<br />
hindurch. Im Sommer ist das Fell braun- bis rötlichgrau, im<br />
Winter etwas heller, fast gelblichgrau.<br />
Biologie<br />
Beim Alpensteinbock dauert die Jugendentwicklung länger<br />
als bei Gämse oder Rothirsch. Steingeissen erreichen die volle<br />
körperliche Entwicklung mit etwa fünf Jahren, Stein böcke<br />
mit etwa acht Jahren. Die zehn- bis zwölfjährigen Böcke<br />
dominieren das Brunftgeschehen. Der Zeitpunkt der Geschlechtsreife<br />
ist keine fixe Grösse und hängt von der Popu -<br />
la tionsgrösse und den herrschenden Umweltbe din gun gen<br />
ab. Sie kann aber bereits mit eineinhalb Jahren eintre ten. Die<br />
Brunftzeit liegt von Ende November bis Anfang Januar. Nach<br />
einer Tragzeit von durchschnittlich 167 Tagen wird zwischen<br />
Ende Mai und Mitte Juni ein Kitz mit einem Gewicht von<br />
rund 3 kg gesetzt. In dem felsigen, steilen Ge län de klettert<br />
das Kitz bereits nach wenigen Tagen seiner Mutter nach.<br />
Böcke leben das Jahr über in gesonderten Bockrudeln.<br />
Die nahe Verwandschaft von Steinbock und Ziegen zeigt<br />
sich auch darin, dass Hausziegen-Alpensteinbock-Hybriden<br />
lebens- und fortpflanzungsfähig sind. Steinwild ernährt sich<br />
zu jeder Jahreszeit zu über 80% von Gräsern, Binsen und<br />
Seggen, ist also ein ausgeprägter Raufutterfresser. Alpine<br />
Zwergsträucher, Flechten sowie Nadelbäume werden auch<br />
im Winter beäst, Rindenschälung an Waldbäumen ist vom<br />
Steinwild nicht bekannt. Der Steinbockpansen ist wie bei<br />
allen Gras-Wiederkäuern verhältnismässig gross und vermag<br />
Abb. 207 Die Grafik zeigt die Bestandsentwicklung und die Abschüsse in der Steinwildkolonie Falknis auf Graubündner<br />
und <strong>Liechtenstein</strong>er Seite. Der Steinwildbestand in der Falkniskolonie wuchs bis 1989 aufgrund guter natürlicher Bedingungen<br />
und fehlender Bejagung stetig an bis auf den gewünschten Bestand von gut 100 Tieren. Um einen überhöhten<br />
Bestand zu verhindern, wurde durch eine zuerst vorsichtige, danach gesteigerte Bejagung der Bestand reguliert und damit<br />
der Kapazität des Lebensraumes angepasst. (Amt für Jagd und Fischerei Graubünden)<br />
Anzahl Tiere<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Bestand<br />
Abschüsse<br />
Prozent<br />
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10<br />
30.0<br />
25.0<br />
20.0<br />
15.0<br />
10.0<br />
5.0<br />
0.0<br />
Prozent