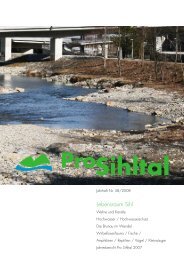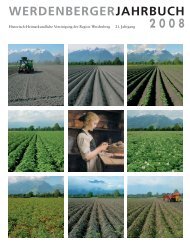Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60<br />
Kleines Mausohr (Myotis oxygnathus)<br />
Ordnung: Fledermäuse (Chiroptera)<br />
Familie: Glattnasen (Vespertilionidae)<br />
Merkmale<br />
Foto: René Güttinger<br />
Leben Fledermäuse an und für sich schon heimlich, gilt dies<br />
aus menschlicher Perspektive ganz besonders für das Kleine<br />
Mausohr. Weil die Art vielerorts in Mischkolonien mit dem<br />
ähnlich aussehenden, aber deutlich häufigeren Grossen<br />
Mausohr lebt, bleibt ihr Vorkommen oft verborgen. Ein<br />
Nachweis ist einzig durch eine akribische Kontrolle von<br />
Mausohrkolonien möglich. Im Alpenrheintal beispielsweise<br />
wurde sie jahrzehntelang übersehen, weil man aus reiner<br />
«Betriebsblindheit» gar nie in Erwägung gezogen hatte,<br />
dass nebst dem Grossen auch das Kleine Mausohr im Gebiet<br />
vorkommen könnte. Erst in den 1990er Jahren führte eine<br />
gezielte regionale Untersuchung zum Nachweis der Art (AR-<br />
LETTAZ et al. 1994).<br />
Das Kleine Mausohr ist trotz seines Artnamens eine der<br />
grössten Fledermausarten Europas und nur unwesentlich<br />
kleiner als das Grosse Mausohr. Es sieht seiner Geschwisterart<br />
sehr ähnlich und ist äusserlich nur anhand bestimmter<br />
Körpermerkmale von diesem zu unterscheiden. So hat das<br />
Kleine Mausohr kürzere und schmälere Ohren, eine leicht<br />
kürzere Schnauze sowie einen bis zur Spitze hell gefärbten<br />
Ohrdeckel. Im Alpenraum besitzen die Tiere am Scheitel<br />
einen Fleck aus hellen Haaren, der beim Grossen Mausohr<br />
fehlt. Zudem ist die obere Zahnreihenlänge vom Eckzahn bis<br />
zum hintersten Backenzahn beim Kleinen Mausohr mit maximal<br />
9,4 mm deutlich kürzer als beim Grossen Mausohr.<br />
Aktuelle DNA-Analysen haben dazu geführt, das europäische<br />
Kleine Mausohr als eigene Art von seinen asiatischen<br />
Verwandten abzutrennen. Der wissenschaftliche Artname<br />
Myotis blythii, unter welchem europäische und asiatische<br />
Kleine Mausohren bislang zusammengefasst wurden, gilt<br />
deshalb nur noch für die asiatische Form.<br />
Biologie<br />
Das Kleine Mausohr lebt vom Frühjahr bis zum Herbst in Tagesquartieren<br />
(Wochenstubenquartiere), die aus Weibchen<br />
und vereinzelt auch aus Männchen bestehen. Männchen<br />
leben überwiegend einzelgängerisch. Die Art gehört zu den<br />
am spätesten ausfliegenden Arten (erst bei deutlicher Dunkelheit),<br />
ist bei geeigneter Witterung während der ganzen<br />
Nacht im Jagdgebiet flugaktiv und kehrt morgens vergleichsweise<br />
früh ins Tagesquartier zurück. Während der Jungenaufzucht<br />
unterbrechen säugende Weibchen gelegentlich die<br />
Jagd und fliegen bereits um Mitternacht ins Tagesquartier<br />
zurück, bevor sie nach einer ein- bis zweistündigen Aktivitätspause<br />
nochmals zur Jagd aufbrechen. Im Jagdgebiet wird<br />
die meist mehrere dutzende Minuten dauernde Flugaktivität<br />
durch regelmässige Ruhepausen unterbrochen.<br />
Die Nahrung besteht zur Hauptsache aus Laubheuschrecken.<br />
Je nach Untersuchungsgebiet und Jahreszeit bilden auch<br />
Schnaken, Feldheuschrecken, Laufkäfer und Maulwurfsgrillen<br />
einen grösseren Nahrungsanteil. Im Alpenrheintal treten<br />
Laubheuschrecken ab Juni in der Nahrung auf und werden<br />
danach zur dominierenden Beute (GÜTTINGER et al. 2006 b).<br />
Bei jahreszeitlichem Massenauftreten können kurzfristig<br />
auch Maikäfer (Mai-Juni) sowie die Wiesenschnake (August-<br />
September) zur Hauptbeute werden. Seine Beute sucht das<br />
Kleine Mausohr im niedrigen Suchflug in Wiesen und Weiden.<br />
Es liest die Beutetiere entweder aus einem kurzen Rüttelflug<br />
direkt von der Vegetation ab oder fängt diese durch<br />
kurze Landungen im Gras (GÜTTINGER et al. 1998).<br />
Die Paarungszeit liegt im August-September, wobei die<br />
Männchen bereits im Juli ihre Balzquartiere besetzen. Diese<br />
befinden sich im peripheren Bereich der Wochenstubenquartiere<br />
oder ausserhalb derselben. Die Männchen locken<br />
paarungswillige Weibchen mit Balzgesängen an und bilden<br />
mit diesen Harems mit bis zu sechs Weibchen. Erst im darauffolgenden<br />
Jahr gebären die Weibchen ihr einzelnes<br />
Jungtier. Die Geburten erfolgen im Alpenrheintal im Juni<br />
(vermutlich vereinzelt auch erst im Juli), wo die Jungtiere ab<br />
Mitte Juli entwöhnt und selbständig werden. Die durchschnittliche<br />
Lebenserwartung wird auf drei bis vier Jahre geschätzt.<br />
Das bekannte Höchstalter markiert ein 33 Jahre<br />
altes Tier aus dem Wallis. Dies ist eine der ältesten bisher gefunden<br />
Fledermäuse weltweit.<br />
In Europa lebt das Kleine Mausohr meist gemeinsam mit<br />
dem Grossen Mausohr im selben Wochenstubenquartier.<br />
Hier nutzen sie in gemischten Gruppen dieselben Hangplätze.<br />
In Höhlenquartieren Süd- und Osteuropas bildet die Art<br />
auch mit weiteren Fledermausarten gemeinsame Cluster.<br />
Abb. 74 Die Triesner Pfarrkirche ist das bedeutendste<br />
Fledermausquartier <strong>Liechtenstein</strong>s – hier leben, in einer<br />
Mischkolonie, Grosses und Kleines Mausohr gemeinsam<br />
unter einem Dach. (Foto: Silvio Hoch)