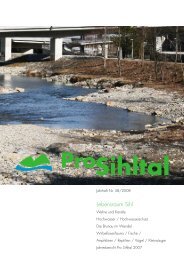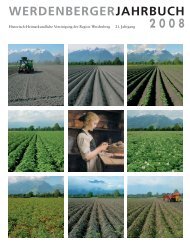Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
168<br />
Rothirsch (Cervus elaphus)<br />
Ordnung: Paarhufer (Artiodactyla)<br />
Familie: Hirsche (Cervidae)<br />
Merkmale<br />
Foto: Markus Stähli<br />
Das charakteristischste Merkmal des Rothirsches ist sein<br />
Geweih. Es besteht aus Knochenmaterial, wird jährlich im<br />
Spätwinter abgeworfen und bis Mitte Sommer wieder neu<br />
aufgebaut. Weibchen und Kälber tragen kein Geweih, wie<br />
das bei allen Cerviden, mit Ausnahme des Rentiers, der Fall<br />
ist. Die Anzahl der Geweihsprossen eines Rothirsches hängt<br />
nicht mit der Höhe des Alters zusammen. Hirsche tragen im<br />
Oberkiefer keine Schneidezähne, die Eckzähne sind in<br />
reduzierter Form als «Grandeln» bei beiden Geschlechtern<br />
ausgebildet. In <strong>Liechtenstein</strong> liegt das Durchschnittsgewicht<br />
der erwachsenen männlichen Rothirsche im Spätsommer<br />
zwischen 130 und 220, das der erwachsenen Hirschkühe<br />
zwischen 100 und 130 Kilogramm. Hirsche sind also rund<br />
fünfmal so schwer wie ein Reh. Im Sommer tragen die Tiere<br />
das namensgebende rotbraune Fell («Rotwild»), im Winter<br />
sind sie graubraun gefärbt. Die Kälber tragen in den ersten<br />
Lebensmonaten zu ihrer Tarnung weisse Flecken auf hellbraunem<br />
Untergrund. Rotwild ist als «Fluchttier» mit grosser<br />
Fluchtdistanz charakterisiert. Es sind ausdauernde Läufer,<br />
hochbeinig, mit gerade verlaufender Wirbelsäule, und mit<br />
einem ausgeprägtem Gesichtssinn und gut ausgebildeten<br />
Riech- und Hörorganen.<br />
Abb. 202 Hirschkuh mit Kalb. (Foto: Markus Stähli)<br />
Biologie<br />
Rothirsche leben wie die Gämse im Rudelverband und sind<br />
im Gegensatz zum Rehwild nicht territorial. Die Rudel<br />
setzen sich aus Muttertieren mehrerer Generationen, den<br />
Kälbern sowie den ein- und teilweise auch den zweijährigen<br />
männlichen Hirschen zusammen. Die drei- und mehrjährigen<br />
männlichen Hirsche leben zusammen in kleinen Gruppen<br />
oder als Einzelgänger und treffen nur zur Brunftzeit Ende<br />
September und Anfang Oktober zu den Familienrudeln. Das<br />
im Mai und Juni nach 34 Wochen Tragzeit geborene Kalb ist<br />
ein Nestflüchter und vermag schon nach ein paar Tagen problemlos<br />
der Mutter zu folgen. Es wird während der ersten<br />
drei bis fünf Lebensmonate gesäugt und bleibt bis nach dem<br />
zweiten Lebensjahr unter der Führung des Muttertieres.<br />
Nach der Geburt des Kalbes stösst das letztjährige Kalb, das<br />
jetzt Schmaltier heisst, zum Verband dazu und bleibt bis<br />
zum kommenden Frühjahr. Oft können deshalb im Sommer<br />
Hirschkuh-Kalb-Schmaltier zusammen beobachtet werden.<br />
Das grössere Rudel folgt in der Regel dem erfahrendsten<br />
Alttier (Leittier), das die besten Einstands- und Nahrungsgebiete<br />
und die günstigsten Wanderrouten kennt und diese<br />
als Tradition an jüngere Tiere weitergibt. Dieses traditionelle<br />
Wissen ist in Rotwildgebieten wie <strong>Liechtenstein</strong>, wo starke<br />
menschliche Störungen und eine fast flächendeckende Erschliessung<br />
der Landschaft im Talraum vorliegen, von besonders<br />
grosser Bedeutung.<br />
Die Nahrungswahl dieses Wiederkäuers ist wenig spezia li siert<br />
und reicht von Gräsern, Kräutern über Stauden, Strauch- und<br />
Baumtrieben bis zu Baumrinden, abhängig vom Störungsgrad,<br />
der Waldbauform, der Höhenlage und Jahreszeit. Eine<br />
künstliche Fütterung im Winter wird in <strong>Liechtenstein</strong> nur in<br />
Form einer Notfütterung mit Heu während extremer<br />
Wetterbedingungen betrieben (KERSTING & NÄSCHER 2008).<br />
Die auffälligsten Lautäusserungen sind die Brunftschreie der<br />
Männchen, von den Jägern als «Röhren» bezeichnet.<br />
Weibchen verständigen sich mit ihren Kälbern durch ein nasales<br />
und wenig auffälliges «Mahnen».<br />
Abb. 203 Hirschrudel am Schönberg. (Foto: Franz Fasel)