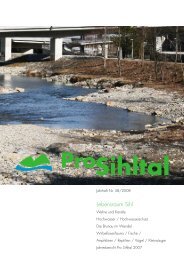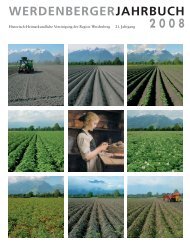Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58<br />
Grosses Mausohr (Myotis myotis)<br />
Ordnung: Fledermäuse (Chiroptera)<br />
Familie: Glattnasen (Vespertilionidae)<br />
Merkmale<br />
Foto: René Güttinger<br />
Das Grosse Mausohr ist die klassische Kirchenfledermaus<br />
schlechthin, welche bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in<br />
Mitteleuropa vom Flachland bis in mittlere Höhenlangen<br />
zahlreiche Kirchendachstöcke bewohnt hat. Aus jener Zeit,<br />
als Fledermäuse bei uns generell noch häufiger waren, ist<br />
diese Fledermausart vielen älteren Personen bestens vertraut<br />
– sei es, weil sie als Kinder Kirchturm und -dachstuhl als<br />
heimliches Spielzimmer benutzten oder weil sie den haufenweise<br />
anfallenden, guanoartigen Kot als wertvollen Gartendünger<br />
einsammeln mussten. Das Grosse Mausohr ist mit<br />
einem Normalgewicht von 20 bis 30 g und einer imposanten<br />
Flügelspannweite von gut 40 cm die grösste Fledermausart<br />
<strong>Liechtenstein</strong>s. Sie ist die namensgebende «Charakterart»<br />
der Gattung Myotis, der «Mausohrverwandten». Typische<br />
Merkmale aller Myotis-Arten sind die recht lange, kräftige<br />
Schnauze, die relativ langen, spitzen Ohren mit einem geraden,<br />
spitz auslaufen Ohrdeckel (Tragus) sowie eine vom dunklen,<br />
in Brauntönen gehaltenen Rückenfell deutlich abgesetzte<br />
helle Unterseite.<br />
Seiner Grösse entsprechend besitzt das Grosse Mausohr<br />
lange und breite Ohren. Das Fell ist auf dem Rücken braun<br />
bis rötlichbraun, auf dem Bauch weissgrau bis beige gefärbt.<br />
Jungtiere sind deutlich grauer gefärbt. Äusserlich kann die<br />
Art leicht mit dem Kleinen Mausohr (Myotis oxygnathus)<br />
verwechselt werden. Das Grosse Mausohr ist im Vergleich jedoch<br />
kräftiger gebaut. Vor allem Schnauze und Ohren sind<br />
deutlich breiter ausgebildet. Sein Ohrdeckel (Tragus) ist an<br />
der Spitze fast immer dunkel pigmentiert. Eine sichere Unterscheidung<br />
der beiden Geschwisterarten ist nur Spezialisten<br />
möglich.<br />
Biologie<br />
Kolonien des Grossen Mausohrs bewohnen vom März bis<br />
Oktober ihre Wochenstubenquartiere. Diese Wochenstubenverbände<br />
setzen sich aus Weibchen mit ihren Jungen sowie<br />
einzelnen, noch nicht geschlechtsreifen Männchen zusammen.<br />
Erwachsene Männchen sind Einzelgänger und nutzen<br />
individuelle Hangplätze in anderen Quartierräumen, gelegentlich<br />
auch in Wochenstubenquartieren, jedoch in gebührendem<br />
Abstand von der Kolonie. Das Grosse Mausohr gehört<br />
zu den am spätesten ausfliegenden Arten, die ihr<br />
Quartier erst bei deutlicher Dunkelheit verlassen und morgens<br />
zeitig zurückkehren. Bei geeigneter Witterung dauert<br />
die Jagd über die ganze Nacht. Während der Jungenaufzucht<br />
können säugende Weibchen die Jagd unterbrechen<br />
und gegen Mitternacht ins Tagesquartier zurückkehren,<br />
bevor sie nach einer ein- bis zweistündigen Ruhepause nochmals<br />
zur Jagd aufbrechen. Im Jagdgebiet wird die meist<br />
mehrere dutzende Minuten dauernde Jagdphase durch regelmässige<br />
Pausen unterbrochen.<br />
Wie in ganz Mitteleuropa stellen Laufkäfer auch bei den<br />
Triesner Grossen Mausohren die Hauptbeute dar (GÜTTINGER<br />
et al. 2006a). Je nach Untersuchungsgebiet und Jahr machen<br />
weitere Beutegruppen einen beträchtlichen Anteil an der<br />
Nahrung aus. So können in <strong>Liechtenstein</strong> im Mai und Juni<br />
Maikäfer gehäuft auftreten und kurzzeitig gar die Nahrung<br />
dominieren. Die ab Juni erbeuteten Feldheuschrecken werden<br />
im August und September, gemeinsam mit den Laufkäfern,<br />
zur wichtigsten Beutegruppe. Seine Beutetiere sucht<br />
das Grosse Mausohr im niedrigen Suchflug über dem Boden.<br />
Es liest die Beutetiere, die es anhand der Laufgeräusche findet,<br />
entweder aus einem kurzen Rüttelflug direkt vom<br />
Boden ab oder fängt diese durch kurze Landungen. Dementsprechend<br />
findet man in der Nahrung praktisch nur grosse,<br />
mit vergleichweise kräftigen Beinen ausgestattete Gliedertiere,<br />
die entweder flugunfähig oder nachts nicht<br />
flugaktiv sind. In dieses Bild passen auch weitere typische<br />
Beutetiergruppen wie Laufkäferlarven, Mistkäfer, Dungkäfer,<br />
Kurzflügler, Feldgrillen, Wiesenschnaken, Hundertfüsser<br />
und Spinnen.<br />
Die Geburten erfolgen im Alpenrheintal im Juni, vereinzelt<br />
auch erst im Juli. Die Jungtiere werden ab Mitte Juli selbständig.<br />
In Jahren mit kühler und regnerischer Sommerwitterung<br />
sterben bis zu 90 Prozent der Jungtiere bereits vor<br />
dem Flüggewerden. Im August verlassen die erwachsenen<br />
Weibchen die Wochenstubenkolonie, um sich mit verschiedenen<br />
Männchen zu paaren. In dieser Jahreszeit (August bis<br />
September) bilden Männchen mit den paarungswilligen<br />
Weibchen Harems mit bis zu fünf Weibchen. Die zunehmend<br />
nur noch aus entwöhnten Jungtieren bestehenden Wochenstubenkolonien<br />
lösen sich im September und Oktober allmählich<br />
auf. Die durchschnittliche Lebenserwartung wird<br />
auf etwas drei bis fünf Jahre geschätzt. Das bekannte Höchstalter<br />
liegt bei 25 Jahren. Saisonale Wanderungen zwischen<br />
Sommer-, herbstlichem Schwärm- und Winterquartieren erstrecken<br />
sich meist im Bereich von 50 bis 100 km. Paarungsquartiere<br />
liegen lediglich bis zu 12 km, Winterquartiere im<br />
Mittel um die 28 km (Männchen) respektive 50 km (Weibchen)<br />
vom Wochenstubenquartier entfernt. Diese Zahlen<br />
gelten für Untersuchungsgebiete in Deutschland.<br />
Im Alpenrheintal lebt das Grosse Mausohr meist gemeinsam<br />
mit dem Kleinen Mausohr im selben Wochenstubenquartier<br />
(GÜTTINGER et al. 2006b). Hier nutzen sie in gemischten Gruppen<br />
dieselben Hangplätze.