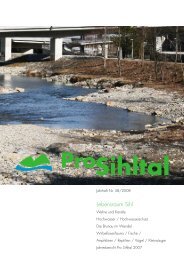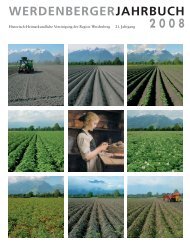Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
180<br />
Auerochse (Ur) (Bos primigenius)<br />
Ordnung: Paarhufer (Artiodactyla)<br />
Familie: Hornträger (Bovidae)<br />
Merkmale<br />
Der Auerochse ist eine ausgestorbene Art der Wildrinder.<br />
Sein Aussehen lässt sich anhand von Höhlenmalereien (z.B.<br />
Höhle von Lascaux, Frankreich), Beschreibungen und Abbildungen<br />
sowie Knochenfunden rekonstruieren. Mit einer<br />
Kopfrumpflänge von über drei Metern, einer Schulterhöhe<br />
von 1.75 bis 1.88 m bei den Bullen und einem Gewicht bis zu<br />
einer Tonne war der Ur bis zur letzten Eiszeit eines der<br />
mächtigsten Landtiere Europas, vergleichbar mit dem<br />
Wisent. Die Hörner wurden bis zu 80 cm lang und waren in<br />
typischer Weise nach vorn geschwungen. Die Weibchen<br />
waren um einen Viertel kleiner. Die Fellfarbe war schwarzbraun.<br />
Nach der Eiszeit nahm der Auerochse in seiner Grösse<br />
deutlich ab.<br />
Biologie<br />
Der Ur lebte in kleinen Herden unter Führung eines älteren<br />
Weibchens, während die Bullen jeweils ihr eigenes Terri to -<br />
rium besetzten und dieses gegen andere Bullen verteidigten.<br />
Es sind drei Unterarten bekann: der europäische,<br />
indische und afrikanische Auerochse. Die modernen europäischen<br />
Hausrinder sind keine direkten Nachkommen des<br />
europäischen Auerochsen. Der Ort ihrer Domestizierung<br />
wird im Nahen Osten bzw. Indien vermutet.<br />
Verbreitung<br />
Der Ur war einmal vom Pazifik über Asien und Europa verbreitet,<br />
ausserdem besiedelte er auch die Gebiete zwischen<br />
nördlicher Tundra und Nordafrika. Sein erstmaliges Auftreten<br />
in Mitteleuropa wird vor etwa 250’000 Jahren angenommen.<br />
Der Ur starb wohl im Mittelmeerraum und in<br />
Asien bereits um die Zeitenwende aus, während er in Mitteleuropa<br />
sehr viel länger beheimatet war.<br />
Der Ur wurde vielfach am Bodenseeufer in der Stein- und<br />
Bronzezeit festgestellt. Man kann sich den Ur gut in den<br />
ehemaligen Rheinauen des Alpenrheintales vorstellen. Er ist<br />
denn auch in den Knochenresten des prähistorischen Sied -<br />
lungsplatzes auf dem Eschner Lutzengüetle in <strong>Liechtenstein</strong><br />
in der Michelsberger- und Horgener Zeit vertreten (HART -<br />
MANN-FRICK 1959). Es sind dies Zeiträume um 3’000 bis 2000<br />
v.Chr. Zur gleichen Datierung gehört ein Knochenfund im<br />
Eschner Riet (BECK 1957). Auch auf der befestigten Höhen -<br />
sied lung auf dem nahen Borscht (Schellenberg) findet<br />
HARTMANN-FRICK (1965) Knochen des Ur, hier auch noch in der<br />
frühen Bronzezeit (ab 1800 v.Chr.) und sehr deutlich als<br />
häufigste Wildart in der Eisenzeit (ab 800 v.Chr.). 1974<br />
wurde in Goldach (St.Gallen) ein gut erhaltenes Skelett eines<br />
Auerochsen gefunden, dessen Alter auf 12’000 Jahre geschätzt<br />
wird. Es liegt in den Sammlungen des Naturmuseums<br />
St. Gallen.<br />
In der Schweiz soll es um das Jahr 1000 noch so viele Urrinder<br />
gegeben haben, dass es in der Wildpretliste der<br />
Benedictiones ad mensas des St.Galler Mönches Ekkehard IV<br />
(ca. 980-1060) zusammen mit Wildpferd und Wisent Aufnah -<br />
me fand. In Mitteleuropa ist der Ur durch die fortschrei -<br />
tende Landwirtschaft und die wirkungsvolleren Waffen um<br />
1400 verdrängt worden, überlebte zunächst aber in Polen,<br />
Litauen und Ostpreussen, wo er für die Jagd des Adels<br />
gehegt worden war. Der letzte bayerische Auerochse soll um<br />
1470 im Neuburger Wald geschossen worden sein<br />
(www.waldwildnis.de/cd/archiv/scherzinger2/index.htm).<br />
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden die allerletzten<br />
Exemplare im Wald von Jaktorow, 55 Kilometer südwestlich<br />
von Warschau unter den Schutz des Landesherren gestellt.<br />
Danach zählte man 1564 acht alte und drei junge Stiere<br />
sowie 22 Kühe und fünf Kälber. 1599 gab es noch 24 Exemplare,<br />
1602 noch vier, 1620 war noch eine Kuh übrig, die 1627<br />
starb. Im polnischen Jaktorow steht hierfür ein Denkmal.<br />
Lebensraum<br />
Der Ur lebte als tagaktives Tier in offenen Wäldern und ernährte<br />
sich von Gräsern, Laub und Eicheln.<br />
Gefährdung und Schutzmassnahmen<br />
Mit der Ausrottung des Ur im Jahre 1627 ist diese Tierart unwiederbringlich<br />
verloren.<br />
In den 1920-er Jahren versuchten die Zoodirektoren Heinz<br />
und Lutz Heck in Hellabrunn-München und in Berlin durch<br />
Rückzuchten ein ähnliches Tier wieder zu erhalten. Sie<br />
kreuzten hierfür spanische und französische Kampfrinder,<br />
das Schottische Hochlandrind und das Ungarische Steppenrind.<br />
Wohl etwas kleiner als der ursprüngliche Ur leben nun<br />
verschiedenenorts physiognomisch ähnliche «Heckrinder».<br />
Mario F. Broggi<br />
Abb. 215 Die Heckrinder ähneln äusserlich am ehesten<br />
dem ausgestorbenen Auerochsen. (Foto: Franz Beer)