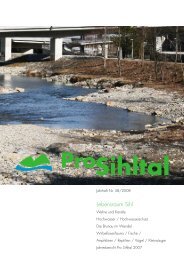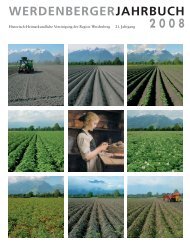Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Layout 1 - Landesverwaltung Liechtenstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
164<br />
Ordnung Paarhufer (Artiodactyla)<br />
Merkmale<br />
Die einheimischen Paarhufer umfassen drei Familien. Die<br />
spezialisierten Pflanzenfresser der Horn- und Geweihträger<br />
unterscheiden sich dabei von den nichtwiederkäuenden und<br />
wenig spezialisierten Allesfressern, den Wildschweinen. Die<br />
Horn- und Geweihträger weisen im Oberkiefer keine Schneidezähne<br />
auf und besitzen einen vierteiligen Magen. Deren<br />
Beinmuskulatur ist körpernah angeordnet. Sie haben durch<br />
die stark verlängerten Mittelhand- und Mittelfussknochen<br />
lange, schlanke Beine, was sie zu schnellen Läufern macht<br />
und sie zu rascher Ortsänderung befähigt. Dadurch können<br />
sie relativ gut vor Raubtieren flüchten und schnell zu guten<br />
Nahrungsräumen gelangen. Sie sind in unterschiedlich hohem<br />
Masse klettergewandt und damit auch gut an das Leben<br />
im Gebirge angepasst.<br />
Alle Paarhufer zeichnen sich durch ausserordentlich gute<br />
Riechorgane aus, was sich jeweils durch den mit Nase und<br />
Mund nach vorn verlängerten Schädel zeigt. Alle vier Läufe<br />
(Beine) stehen auf den äussersten Spitzen der 3. und 4. Zehe<br />
(Zehenspitzengänger). Die 2. und 5. Zehe ist als sogenannte<br />
Afterklaue ausgebildet. Sie ist deutlich kleiner, rückwärtig erhöht<br />
angelegt und berührt den Boden in der Regel nicht, ausser<br />
bei festem Tritt durch schnelle Flucht oder bei Schweinen<br />
im nassen Untergrund. Bei Schweinen sind die Mittelhandknochen<br />
noch getrennt, bei Hirschen und Hornträgern sind<br />
sie zu einem festen Knochen verwachsen. Die erste Zehe ist<br />
bei allen Paarhufern im Laufe der Evolution mit den anderen<br />
Hand- oder Fussknochen verwachsen und nicht mehr sichtbar.<br />
Biologie<br />
Paarhufer leben häufig in Sozialverbänden, die je nach Art<br />
unterschiedlich aufgebaut sein können. Ausserhalb der<br />
Paarungszeit leben junge männliche Tiere oft in gleich -<br />
geschlechtlichen Gruppen, während alte Männchen Einzelgänger<br />
sein können. Männchen sind sowohl bei den Wiederkäuern<br />
als auch bei den Echten Schweinen bedeutend<br />
grösser, kräftiger, und schwerer gebaut als weibliche Tiere.<br />
Wiederkäuende Paarhufer gebären in der Regel nur ein bis<br />
zwei Jungtiere pro Jahr. Diese sind jedoch auf Grund der<br />
langen Tragzeit weitentwickelt und daher Nestflüchter, die<br />
schon nach wenigen Stunden laufen können. Schweine<br />
haben mit vier bis acht Jungen mehr Nachwuchs.<br />
Alle Paarhufer, mit Ausnahme der Echten Schweine, sind<br />
Wiederkäuer und besitzen spezialisierte vierkammerige<br />
Mägen und einen verlängerten Darm. Diese Anpassungen<br />
bieten den Vorteil, dass die schwer verdauliche zellulosehaltige<br />
Pflanzennahrung besser aufgeschlossen wird.<br />
Zahlreiche Feinde wie Fuchs, Wolf, Luchs, Bär, und Stein -<br />
adler stellen den Paarhufern nach. Der Gehörsinn und der<br />
Geruchsinn ist bei allen Arten hervorragend ausgeprägt. Die<br />
vor allem auf Bewegungen empfindlich reagierenden<br />
Augen befinden sich seitlich am Kopf, um eine nahezu<br />
Rundumsicht zu gewährleisten.<br />
Familien<br />
Echte Schweine (Suidae)<br />
Die Schweine sind stämmig gebaut und gehen auf relativ<br />
kurzen, kräftigen Beinen. Sie sind Paarhufer, Allesfresser,<br />
aber keine Wiederkäuer. Die langen Eckzähne sind bei unserem<br />
einzigen Vertreter, dem Wildschwein, als Waffen und<br />
Grabwerkzeuge ausgebildet. Im FL: 1 Art<br />
Hirsche (Cervidae)<br />
Bei den Hirschartigen tragen, mit Ausnahme des Rentieres<br />
nur die Männchen Geweihe auf einem Knochenfortsatz am<br />
Scheitelpunkt des Schädels (Stirnzapfen). Beim Hirsch- oder<br />
Rehgeweih handelt es sich um totes Knochenmaterial, das<br />
mehrfach verzweigt ist und jährlich abgeworfen und neu<br />
gebildet wird. Nur während des jährlichen Wachstums sind<br />
die Geweihe durchblutet und mit Nervenbahnen versehen.<br />
Den Knochen umgibt eine schützende, behaarte Haut (Bast).<br />
Dieser vertrocknet nach Erreichen des Wachstumsendstadiums<br />
und wird abgestreift. Geweihe entspringen aus dem<br />
Knochenskelett. Die Anzahl der Geweihsprossen ist nicht mit<br />
dem Alter des Tieres gleich zu setzen. Im FL: 3 Arten (davon<br />
eine ausgestorben)<br />
Hornträger (Bovidae)<br />
Weibchen und Männchen der Boviden tragen Stirnwaffen.<br />
Die Hörner der Boviden sind je nach Tierart mehr oder weniger<br />
gekrümmt, nie verzweigt, bestehen aus Hornmaterial,<br />
entstammen aus der Haut und sitzen auf einem durchbluteten<br />
Knochenzapfen am Scheitel des Schädels. Hörner werden<br />
nicht abgeworfen und wachsen jedes Jahr ein Stück<br />
weiter, wobei der Wachstumsstillstand im Winter einen<br />
sichtbaren Jahrring bildet, der die genaue Altersansprache<br />
erlaubt. Im FL: 4 Arten (davon zwei ausgestorben)<br />
Abb. 200 Rothirsch. (Foto: Markus Stähli)<br />
Michael Fasel